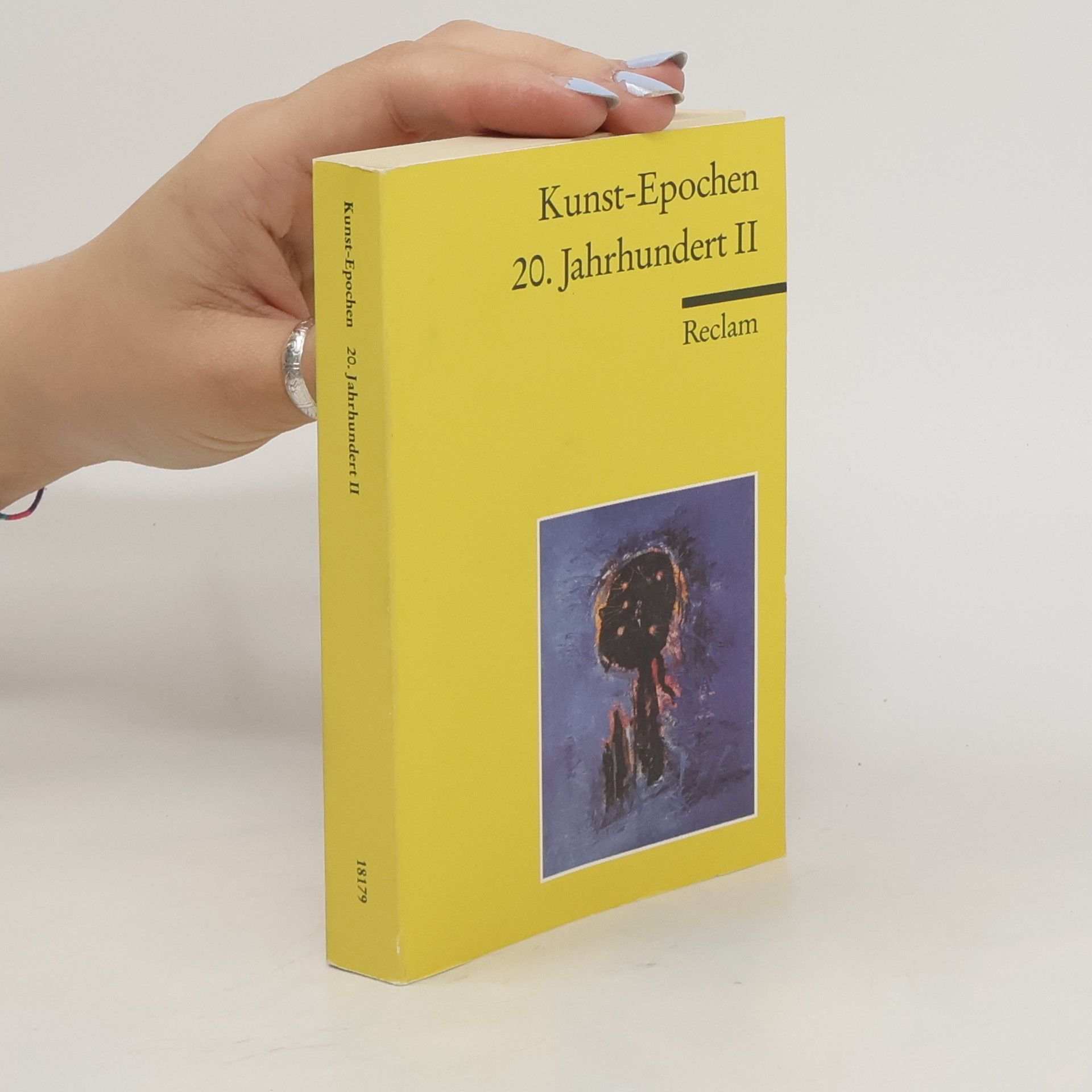Die zwölfbändige Reihe 'Kunst-Epochen' bietet einen fundierten Einstieg in die Kunstgeschichte, von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Sie begleitet den Leser auf dem Weg zur Kunst, macht mit den Hintergründen, den wichtigsten Künstlern und Werken vertraut. Gleichzeitig zeigt sie Methoden auf, mit deren Hilfe man Bilder, Plastiken und Bauwerke erschließen und verstehen lernen kann. Der Aufbau der Bände: Die verschiedenen Epochen und ihre wichtigsten künstlerischen Strömungen - Epochale Errungenschaften und herausragenden Einzelwerke - Materialien und Quellen zum zeitgenössischen Kunstverständnis - Die wichtigsten Künstler, ihr Leben und Werk, Künstlergruppen - Personenregister und Literaturhinweise. Band 12: Die Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist durch die Nähe zu Alltagskultur, Wissenschaft und Neuen Medien, den Einsatz bislang nicht kunstwürdiger Materialien und die Diskussion über die Wahrnehmung von Kunst gekennzeichnet. Die Internationalisierung verdrängt regionale Eigenheiten, die Persönlichkeit des Künstlers steht im Zentrum.
Ulrich Reißer Knihy