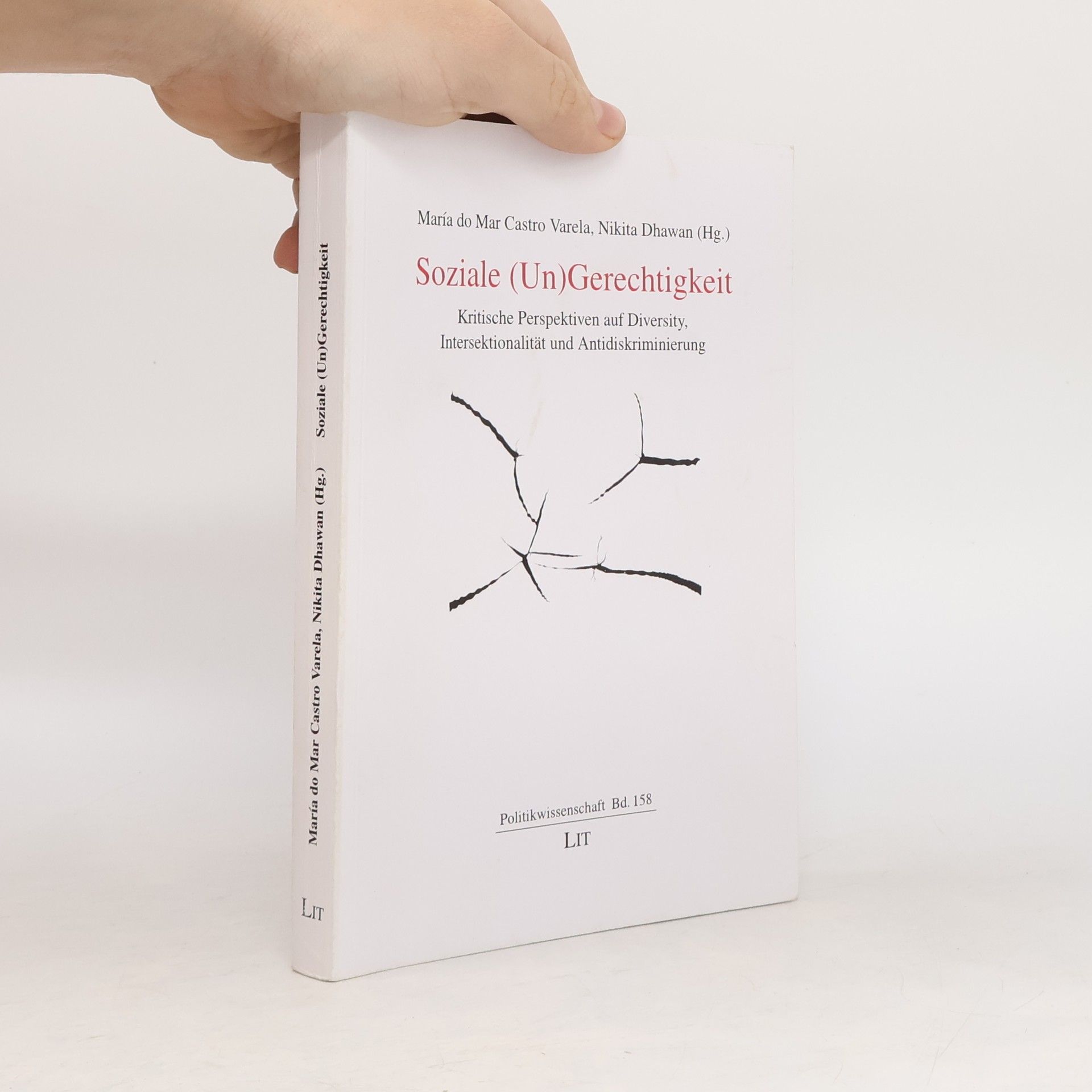Eine Einführung in das komplexe, interdisziplinäre Forschungsfeld der postkolonialen Theorie im deutschsprachigen Raum ist längst überfällig. Der Band entfaltet auf virtuose Weise die Facetten dieser bedeutenden Perspektive, die die Fortdauer, Folgen und Wirkungen kolonialer Diskurse und Praktiken auf gegenwärtige politische sowie wissenschaftliche Strukturen untersucht. Die anspruchsvollen Schriften von Gayatri Spivak und Homi Bhabha werden klar und verständlich für Nicht-Spezialisten aufbereitet, während die oft vernachlässigte Arbeit von Edward Said nuanciert dargestellt wird. Mit einer souveränen Mischung aus Engagement und kritischer Distanz trägt der Band dazu bei, die verspätete Rezeption postkolonialer Theorien in Deutschland voranzutreiben und zu versachlichen. Er wandelt die häufig polemische Auseinandersetzung mit dieser neuen Forschungsrichtung in eine ernsthafte, produktive Beschäftigung um und zeigt deren Relevanz für den deutschen Kontext auf. Die klare und kompetente Darstellung der Hauptrichtungen postkolonialer Theorie sowie der kritische Ansatz des Buchs könnten zur produktiven Erweiterung dieser Theorien, insbesondere in der neueren deutschsprachigen Rezeption, beitragen.
María do Mar Castro Varela Knihy






Postkoloniale Pädagogik
Affirmativ-sabotierende Relektüren des pädagogischen Kanons
- 200 stránek
- 7 hodin čtení
Das Schlagwort »postkolonial« kursiert seit geraumer Zeit in den verschiedensten Feldern der Pädagogik. Bislang fehlte im deutschsprachigen Raum jedoch eine systematische Darstellung. Im vorliegenden Band wird nicht nur in die grundlegenden Konzepte (Subalternität, affirmative Sabotage, Othering, Hybridität usw.) eingeführt, sondern darüber hinaus werden die Verflechtungen mit den als kanonisch verstandenen Werken der Pädagogik im Sinne einer dekonstruktiven Relektüre herausgearbeitet. Durch diesen Fokus wird verdeutlicht, dass postkoloniale Theorie weder ein Add-On noch ein exotisches Pflänzchen ist: Vielmehr kann sie Theoriebildung durch Dezentrierung und Kanonkritik in Bewegung setzen.
Sind Menschen in der Grundsicherung arm?
Eine Analyse ihrer sozialen (Selbst-)Verortung von Herbert Jacobs
Menschen, die Grundsicherungsleistungen beziehen, gelten gemeinhin als arm. Herbert Jacobs hinterfragt gängige Armutskonzepte, analysiert die Beziehung zwischen Hilfegebenden und Hilfeempfangenden und stellt fest, dass der alleinige Fokus auf ein niedriges Einkommen nicht ausreicht, um die komplexe Situation des staatlichen Hilfebezugs zu erfassen. Auf Grundlage einer qualitativen Befragung von Menschen im Grundsicherungsbezug entwickelt er eine Typologie ihrer Strategien, den Bezug von Mindestsicherungsleistungen biografisch zu verarbeiten und sich gesellschaftlich zu verorten.
Das Erstarken einer neuen rechten Bewegung einerseits und einer vermeintlich linken Identitätspolitik andererseits, macht Allianzbildungen über die jeweils eigene Identität hinaus beinahe unmöglich. Wir nehmen diese Beobachtung zum Anlass, um über einen weiteren Begriff der politischen Praxis nachzudenken, den der Freund*innenschaft. Als ›bloß‹ zwischenmenschliche Beziehung wird diese meist ins Private verdammt, dabei sind Freund*innenschaften genuin auch politische Beziehungen, deren grundlegende Charakteristika unseren Blick auf die Welt transformieren können. Der dritte Band der Reihe »resistance & desire« erörtert die Frage, ob Freund*innenschaft als Konzept der politischen Beziehungs- und Allianzbildung taugt. Welche Überlegungen haben etwa Michel Foucault, Judith Butler oder bell hooks zu diesem Thema angestellt? Anschließend versuchen wir, diese für einen überarbeiteten Begriff von Freund*innenschaft als politische Praxis produktiv zu machen. Denn gebraucht wird das Potential, das ihr innewohnt, in Zeiten multipler Krisen und wachsender globaler Ungleichheiten mehr denn je.
Antonio Gramsci gilt als meistzitierter italienischer Autor in den Geistes- und Sozialwissenschaften seit Machiavelli. Die Auseinandersetzung mit Gramsci prägt nicht nur die Cultural Studies, sondern ist auch Grundlage für Perspektiven kritischer Pädagogik. Das gilt auch zunehmend für den deutschsprachigen Diskurs, in dem bisher eine systematische Rezeption von Gramscis Werk in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften aussteht. Der vorliegende Band versammelt aktuelle transdisziplinäre und transnationale Beiträge und versteht sich als Anstoß zum Weiterdenken – in a Gramscian way. Die freie Verfügbarkeit der E-Book-Ausgabe dieser Publikation wurde ermöglicht durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, den Fachinformationsdienst Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung und ein Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften.
Double Bind postkolonial
Kritische Perspektiven auf Kunst und Kulturelle Bildung
- 310 stránek
- 11 hodin čtení
Postkoloniale Perspektiven im Kunstbetrieb und in der Kulturellen Bildung haben Hochkonjunktur. Doch werden diese Konzepte meist genutzt, ohne dass eine tiefergreifende Auseinandersetzung mit ihnen stattfindet. Dabei wären umfassendere Debatten um und mit Theorien des Postkolonialismus dringend notwendig, etwa, um die Zumutungen der dominanten eurozentrischen Ausstellungs- und Vermittlungspraxen aufzudecken. Die Beiträge des Bandes beleuchten die Verantwortung der Kunst und Kunstvermittlung aus einer explizit postkolonialen Perspektive. Der Fokus liegt dabei auf dem »double bind«, der das Feld durchzieht und sich äußert in einer dilemmatischen Position zwischen Subversion und Affirmation. Dabei werden sowohl diskriminierende Praxen im Feld entlarvt als auch eine (auto-)kritische Theorieentwicklung vorangetrieben.
Migration, Gender, Arbeitsmarkt
- 238 stránek
- 9 hodin čtení
In der BRD widmete sich die klassische Arbeitsmarkt- und Migrationsforschung bereits seit den 70er Jahren dem Thema Einwanderung, beschränkte sich jedoch weitgehend auf die Situation ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Familien. Das vorliegende Buch thematisiert die spezifische Situation von Migrantinnen – insbesondere aus Drittstaatenländern und von Hochqualifizierten –, deren wirtschaftliche Bedeutung vor dem Hintergrund fortschreitender Globalisierung eher noch zunehmen wird. María do Mar Castro Varela, geb. 1964 in A Coruña (Spanien); Dipl.-Psych. und Dipl.-Päd., promoviert in Politikwissenschaften. Freie Wissenschaftlerin, Lehrbeauftragte an der FH Köln. Schwerpunkte: Migration, Diskriminierungsanalysen, Utopien, Genderforschung.
Soziale (Un)Gerechtigkeit
kritische Perspektiven auf Diversity, Intersektionalität und Antidiskriminierung
- 256 stránek
- 9 hodin čtení