Peter Drescher Knihy

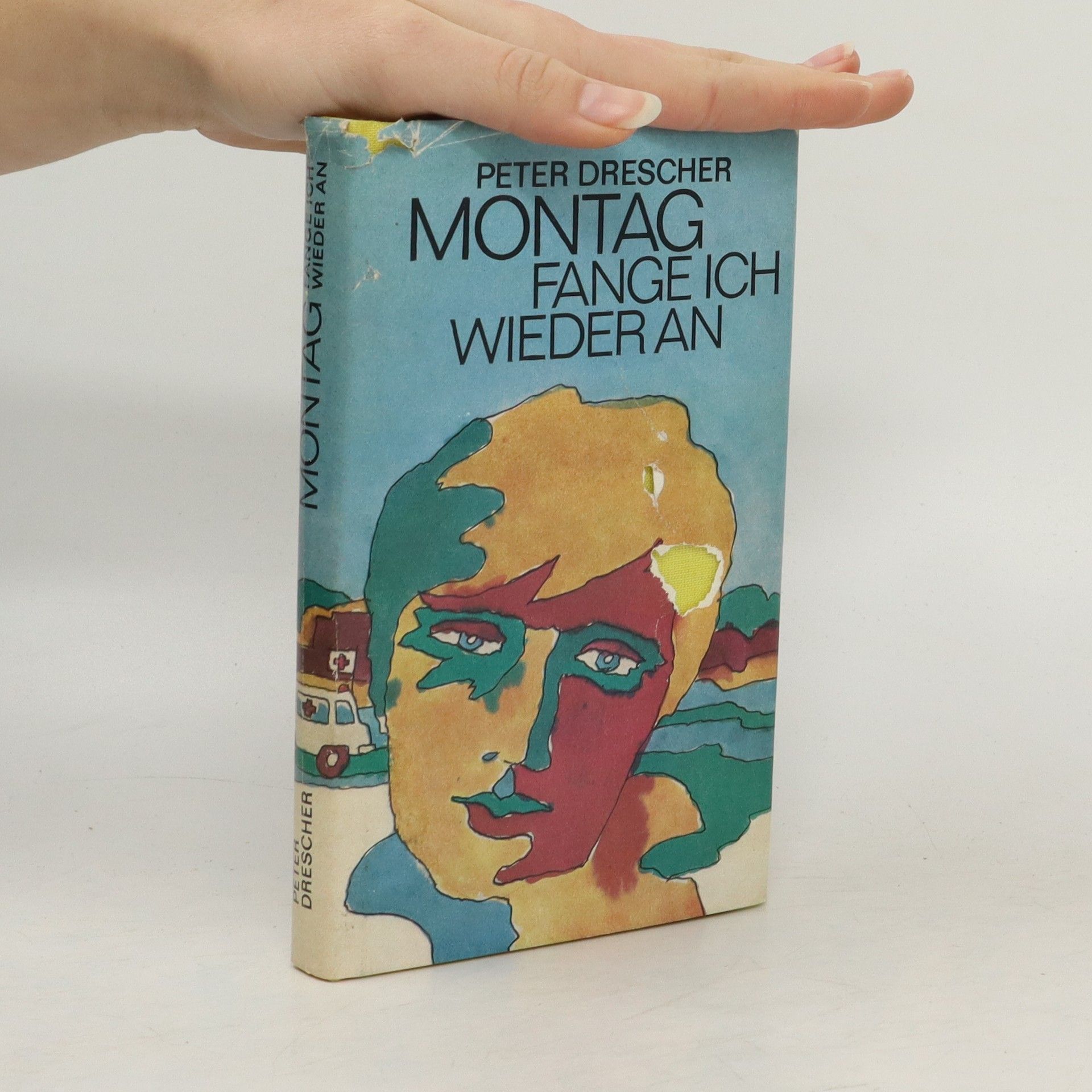
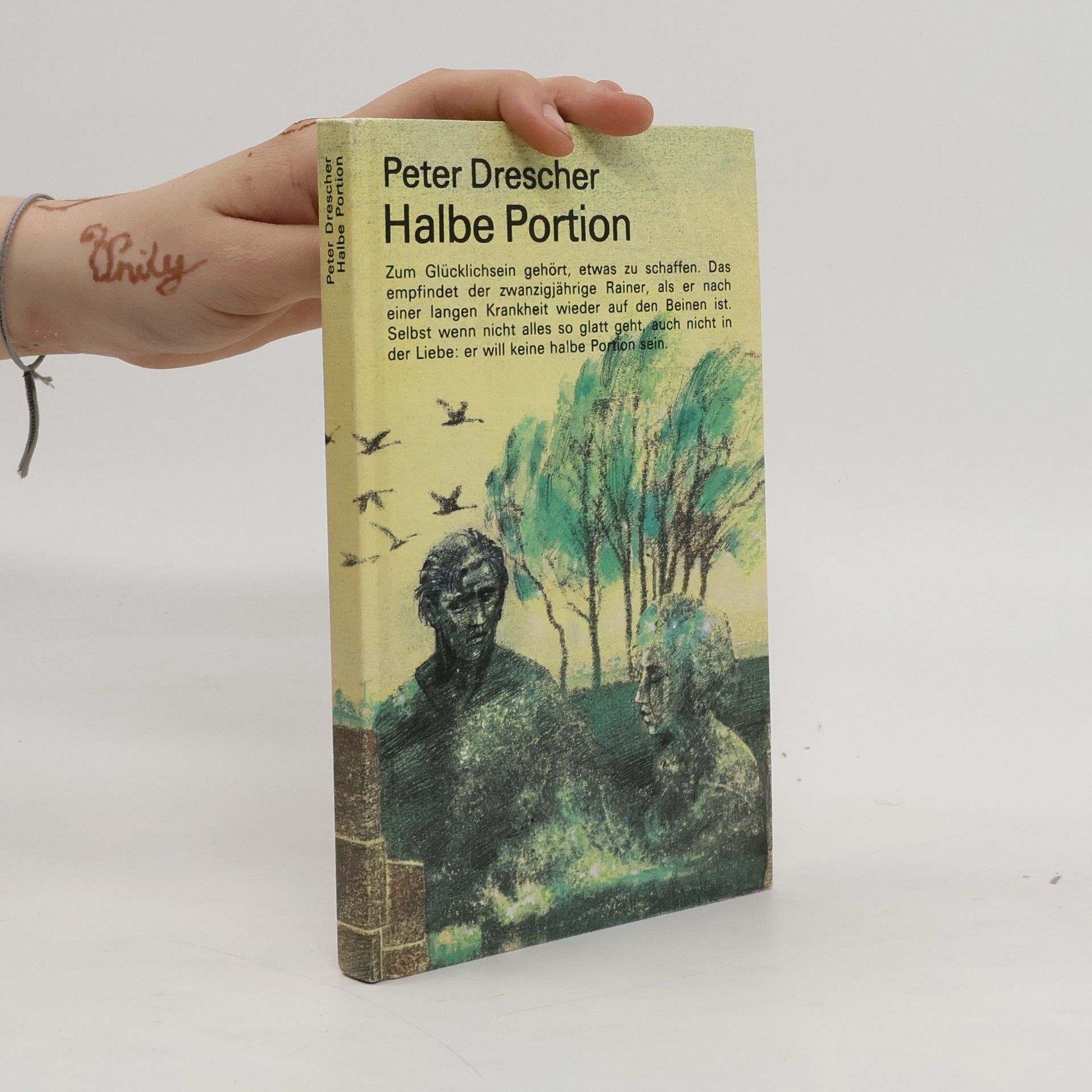
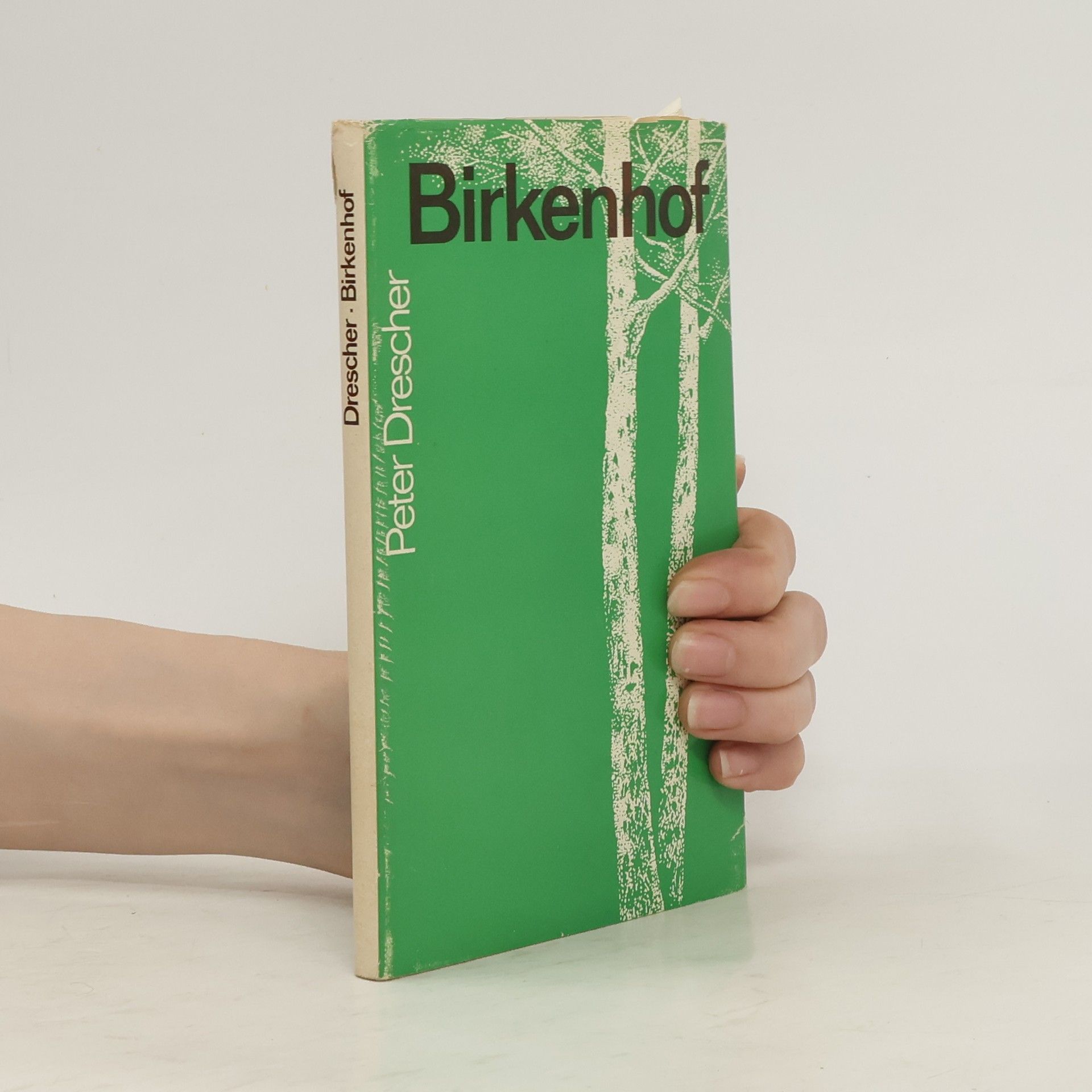
Halbe Portion
- 168 stránek
- 6 hodin čtení
Moderation von Arbeitsgruppen und Qualitätszirkeln
- 180 stránek
- 7 hodin čtení
»Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben.« Oder: »Die vorliegende Dienstanweisung ist bis zur nächsten Woche umzusetzen! Noch Fragen? Keine. Ich bitte, an die Arbeit zu gehen!« – Wer kennt nicht diesen oder jenen Satz am Ende einer Arbeitsbesprechung: Kein konkretes Ergebnis, keine Partizipation, Missverständnisse allenthalben, Demotivation macht sich breit, die Beziehungsqualität leidet, die Produktivität lässt nach. Damit ist auch schon die Zielsetzung Peter Dreschers umrissen. Er will Moderationsfähigkeit vermitteln, psychologische Kompetenzen für die Arbeit mit Teams fördern und in erster Linie praxisbezogenes Handwerkszeug liefern, unter welchen Bedingungen welche Moderationstechniken am effektivsten eingesetzt werden können, um Mitarbeiter und Kollegen zu motivieren, Konflikte besser handhaben zu können, die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen und damit das Betriebsergebnis zu verbessern. Ein Kapitel widmet er den speziellen Anforderung der Moderation von Qualitätszirkeln. Im besten Sinn eines Handbuchs wird das Vorgehen im Detail beschrieben, es werden Beispiele zur Visualisierung dargestellt, dem Moderator werden Checklisten und Planungsabläufe an die Hand gegeben, so dass immer ein Nachschlagen möglich ist und rasch Sicherheit in der Moderatorenrolle erlangt werden kann.