Schneeflocken fallen in die Sonne
Christuserfahrungen auf dem Zen Weg
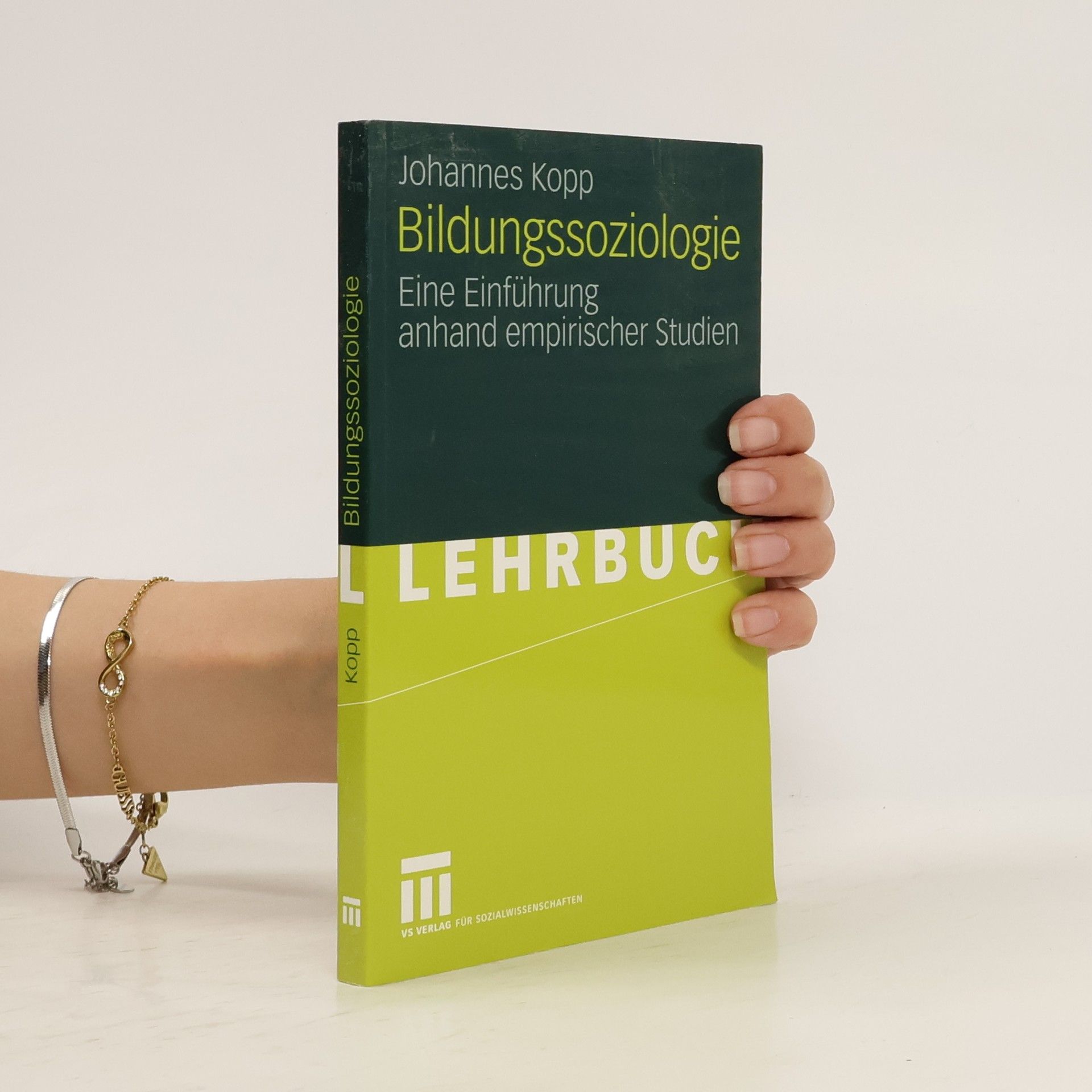


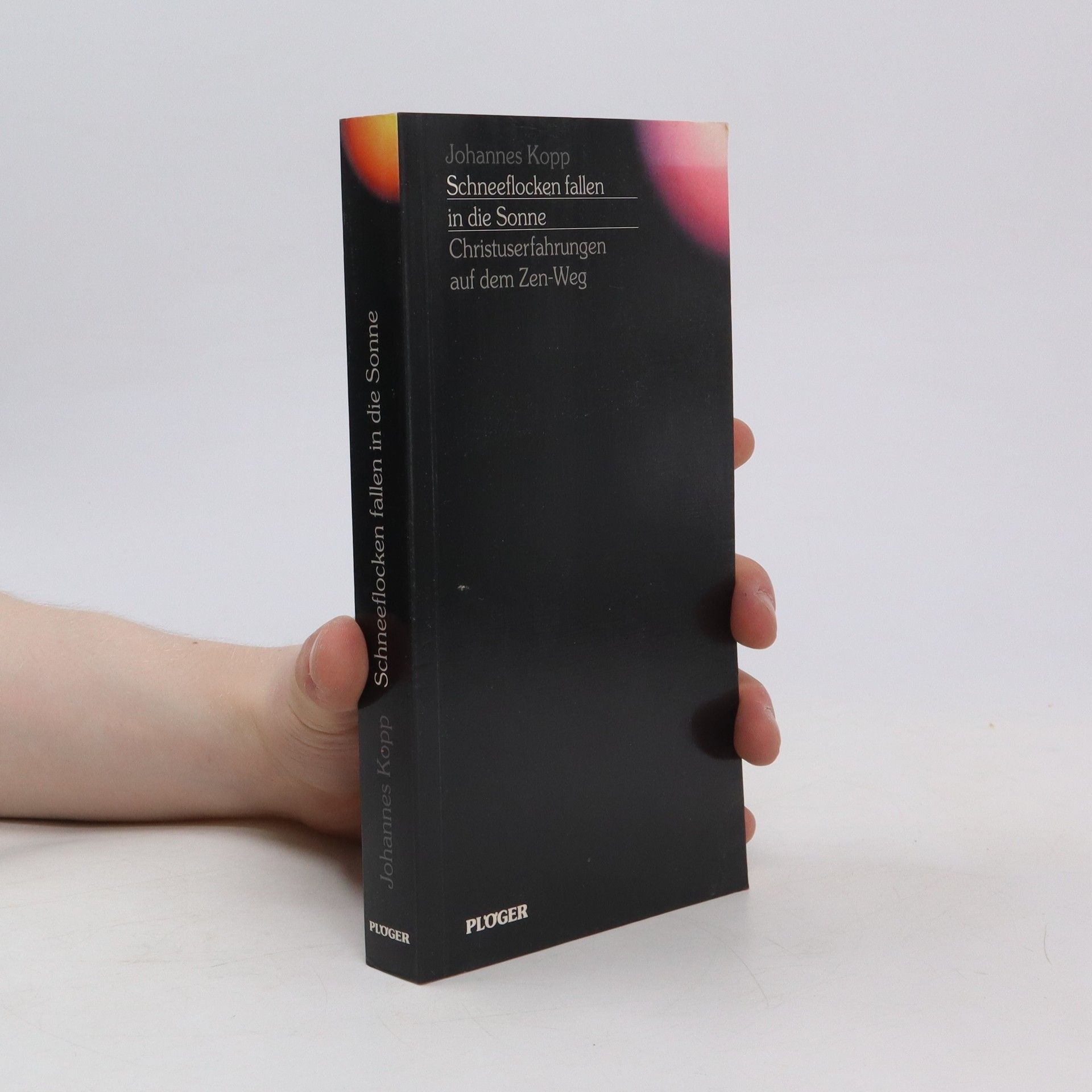
Christuserfahrungen auf dem Zen Weg
Zur Lage der wohnenden Klasse in Trier
Die in dem diesem Band vereinten Überlegungen, Aufsätze und Beiträge präsentieren anhand konkreter Beispiele die unterschiedlichen Forschungsperspektiven zu gemeinschaftlichen Wohnformen. Wohnen ist nicht nur Schutz vor Kälte und Regen oder ein Platz zum Schlafen. Wohnen vermittelt auch Gemeinschaft – sei dies primär im Bereich der Familie oder erweitert in der Nachbarschaft und Gemeinschaft. Nicht überall werden diese Funktionen aber gleich gut erfüllt. Anhand verschiedener Fallstudien soll untersucht werden, unter welchen Bedingungen gutes, resonantes Wohnen gelingt und wann es eher zu entfremdeten Wohnformen kommt.
Das Buch soll für die begriffliche und theoretische Grundlegung der Soziologie eine verlässliche Orientierung und Einführung bieten. Mit 104 Artikeln hält sich das Lexikon zwar an der Untergrenze der erforderlichen Grundbegriffe, doch wird in diesen Artikeln eine große Anzahl weiterer soziologischer und sozialwissenschaftlicher Fachausdrücke aufgenommen und erklärt. Ein sorgfältig erarbeitetes Sachregister hilft bei der Erschließung aller relevanten Begriffe.
Bildung ist eines der wichtigsten Themen im Bereich der sozialen Ungleichheit, und spätestens seit den Ergebnissen der PISA-Studie finden die verschiedenen wissenschaftlichen Diskussionen auch in der Öffentlichkeit wieder Resonanz. Ziel dieser Einführung ist es nun, einen Überblick über die verschiedenen Diskussionslinien der Bildungssoziologie und deren Ergebnisse zu geben. Dabei beginnt dieser Überblick bei der historischen Bildungsforschung, die die Wurzeln einiger auch noch heute das Bildungssystem bestimmender Charakteristika wie etwa dessen Dreigliedrigkeit aufzeigt, konzentriert sich danach aber auch auf die Frage der schichtspezifischen Bildungsungleichheit. Hierbei sollen sowohl die älteren, als auch neuere empirische Studien zu dieser Fragestellung und ihre jeweilige theoretische Fundierung vorgestellt werden. Den Abschluss dieser Darstellung bildet die Frage nach der ethnischen Dimension sozialer Ungleichheit. In dieser Einführung werden die wichtigsten theoretischen Diskussionslinien, vor allem aber die jeweiligen empirischen Studien und ihre Ergebnisse in einer übersichtlichen und verständlichen Art vorgestellt.