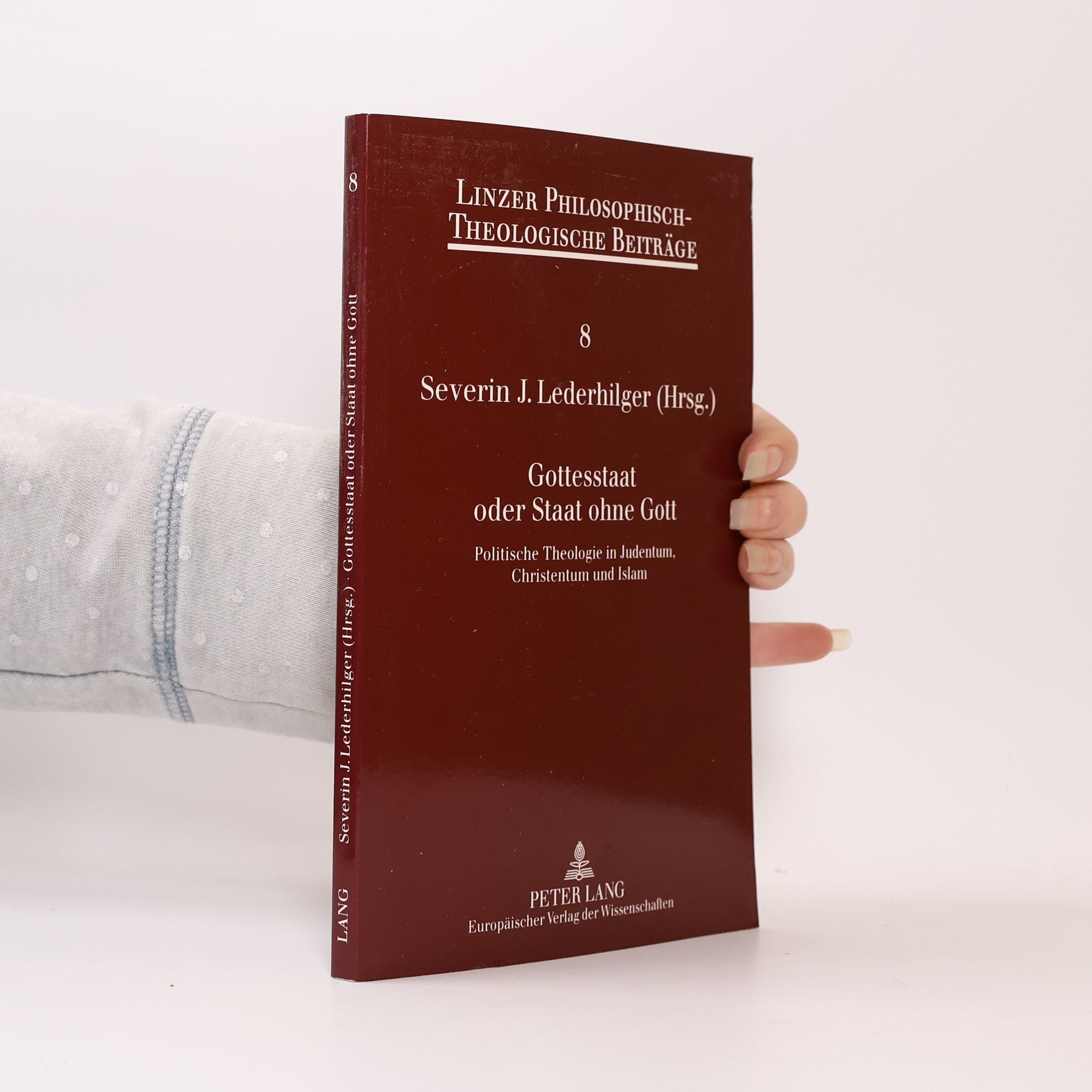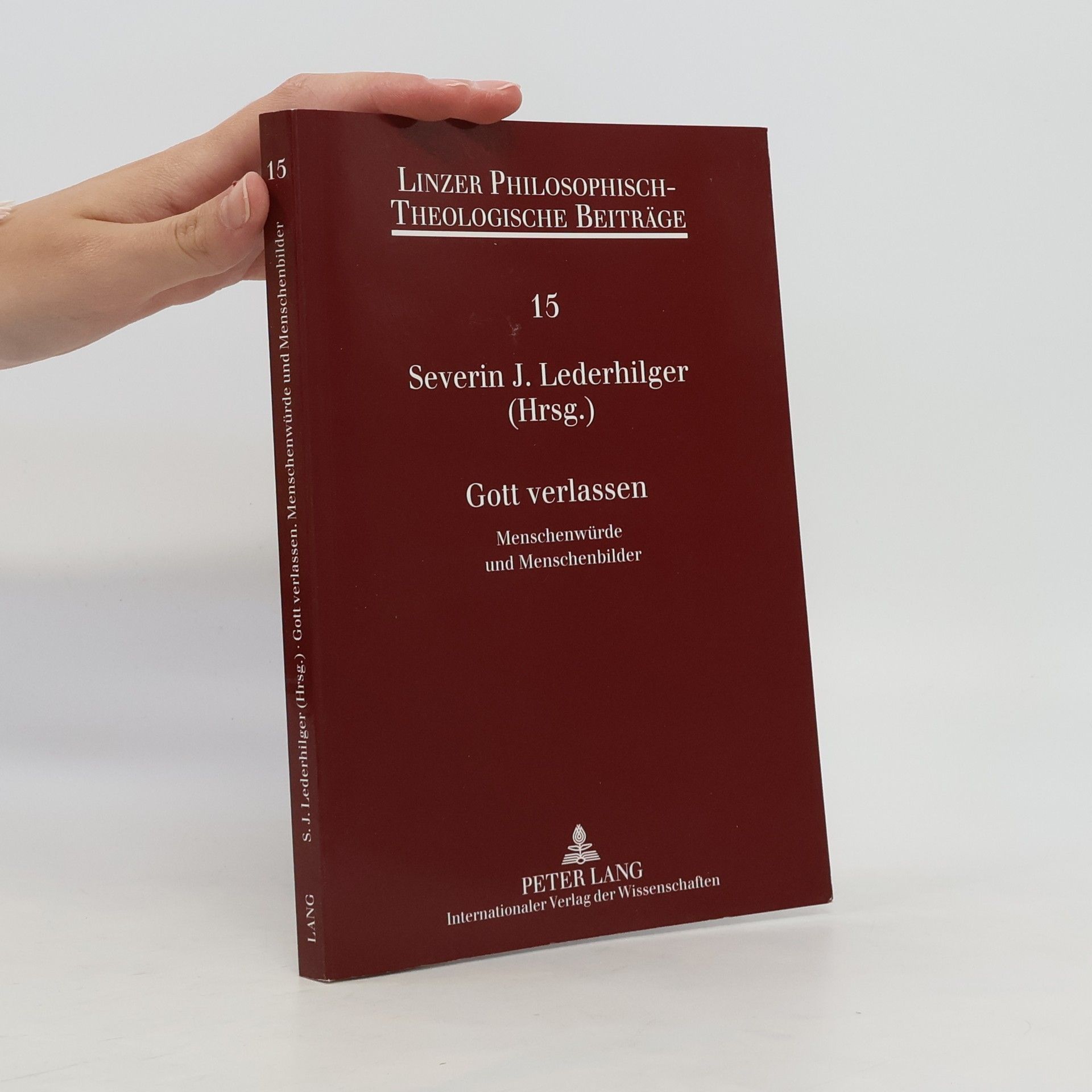Die gespaltene Gesellschaft
Analysen, Perspektiven und die Aufgaben der Kirchen
- 176 stránek
- 7 hodin čtení
Die Kluft zwischen den diversen Milieus unserer Gesellschaft wächst. Soziale Spannungen, ethnische und religiöse Konflikte, radikalisierte Gewalthandlungen nehmen zu. Die unbewältigten Ursachen und Folgen der Migration sowie eine wachsende Infrage-stellung menschenrechtlicher Grundhaltungen gehören zu den Herausforderungen der Gegenwart. Pluralismus, Wohlstand und Chancengleichheit werden in der politischen Rhetorik zwar gern als Eckpfeiler des Zusammenlebens propagiert, bei genauerer Betrachtung sind sie aber ins Wanken geraten. Mit einem nüchternen Blick auf die Fakten werden die sozialen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen in Österreich und Deutschland analysiert und konkrete gesellschaftspolitische, sozialethische und pastorale Reaktionsmöglichkeiten – gerade auch seitens der Kirchen aufgrund ihres biblischen Menschenbildes – benannt.