Mielkes Revier
- 253 stránek
- 9 hodin čtení
Stadtraum und Alltag rund um die MfS-Zentrale in Berlin-Lichtenberg


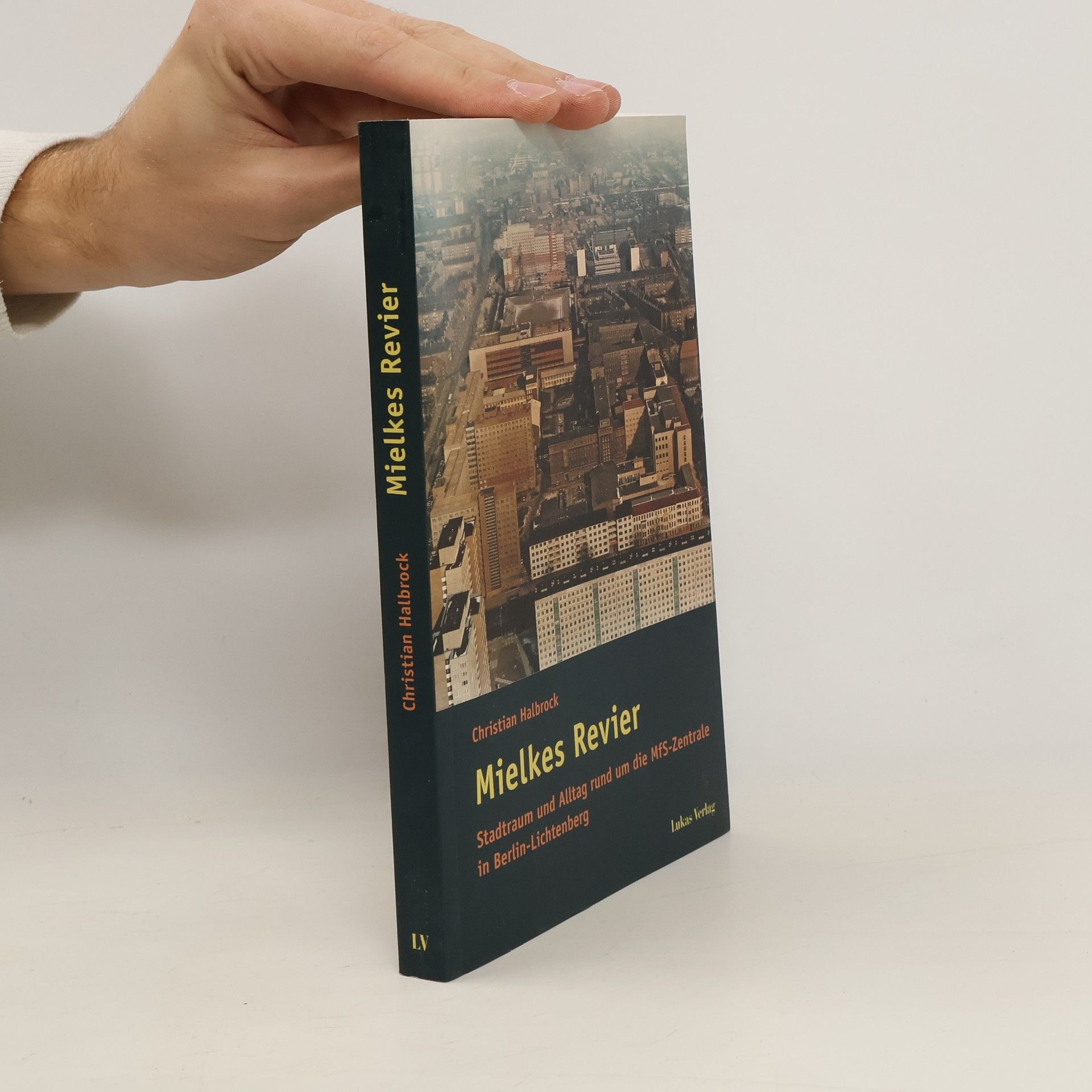
Stadtraum und Alltag rund um die MfS-Zentrale in Berlin-Lichtenberg
Wer hat wo was entschieden?
Von 1950 bis 1990 war die Zentrale der DDR-Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg ansässig, von wo aus die Ministeriumsspitze die Arbeit der Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen der gesamten DDR koordinierte und Auslandsspionage gegen den Westen betrieb. Die in Lichtenberg erlassenen Befehle und Richtlinien bildeten die Grundlage für Maßnahmen gegen Regimekritiker und Andersdenkende. Der vorliegende Band erläutert anhand zahlreicher Originaldokumente, Fotos und Pläne die Funktion der einzelnen Bauten auf dem Gelände der MfS-Zentrale. Diese umfassten nicht nur Büros der hauptamtlichen Mitarbeiter, sondern auch zentrale Karteien, Archivablagen, Einrichtungen für Funk- und Kommunikationsnetze sowie Post- und Telefonüberwachung. Zudem beinhaltete das Gelände Gesundheits-, Dienstleistungs- und Sporteinrichtungen für die Mitarbeiter sowie eine Untersuchungshaftanstalt des MfS. In gesondert markierten Abschnitten wird das leitende Personal der Stasi vorgestellt. So entsteht ein anschauliches Bild der Geschichte des Geländes, des Auf- und Ausbaus der Zentrale und der umfassenden Kontrolle, die der zentrale Apparat der Staatssicherheit über Jahrzehnte ausübte. Die Darstellung dient sowohl als Führer über das Gelände in Lichtenberg als auch als illustrierte Einführung in die Geschichte des Ministeriums für Staatssicherheit.
Die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Berlin-Lichtenberg war bis 1989 ein geheimnisumwitterter Ort. Wer die Frankfurter Allee stadtauswärts fuhr, passierte noch vor der Lichtenberger Brücke den knapp zwei Quadratkilometer großen Ministerialkomplex, der den Willen der SED zur Durchsetzung ihres Herrschaftsanspruches symbolisierte. Mit dem ab 1950 forcierten Ausbau der Stasi-Zentrale entstand eine hermetisch abgeriegelte und misstrauisch bewachte Sperrzone mitten in einem vor dem gewöhnlichen Wohngebiet - eine Stadt innerhalb der Stadt, in der bis zu 7000 MfS-Mitarbeiter tätig waren. Christian Halbrocks historischer Rundgang führt nicht nur mit detaillierten Informationen und zahlreichen Abbildungen durch das übermächtige Bauensemble rund um die Normannenstraße, sondern zeigt auch, wie sich das Stadtviertel und das Leben in den angrenzenden Straßenzügen zwischen 1950 bis 1989 veränderten und welche "Anwohneraktivitäten" vor allem das Misstrauen des Staatssicherheitsdienstes hervorriefen