Hannah Lotte Lund Knihy


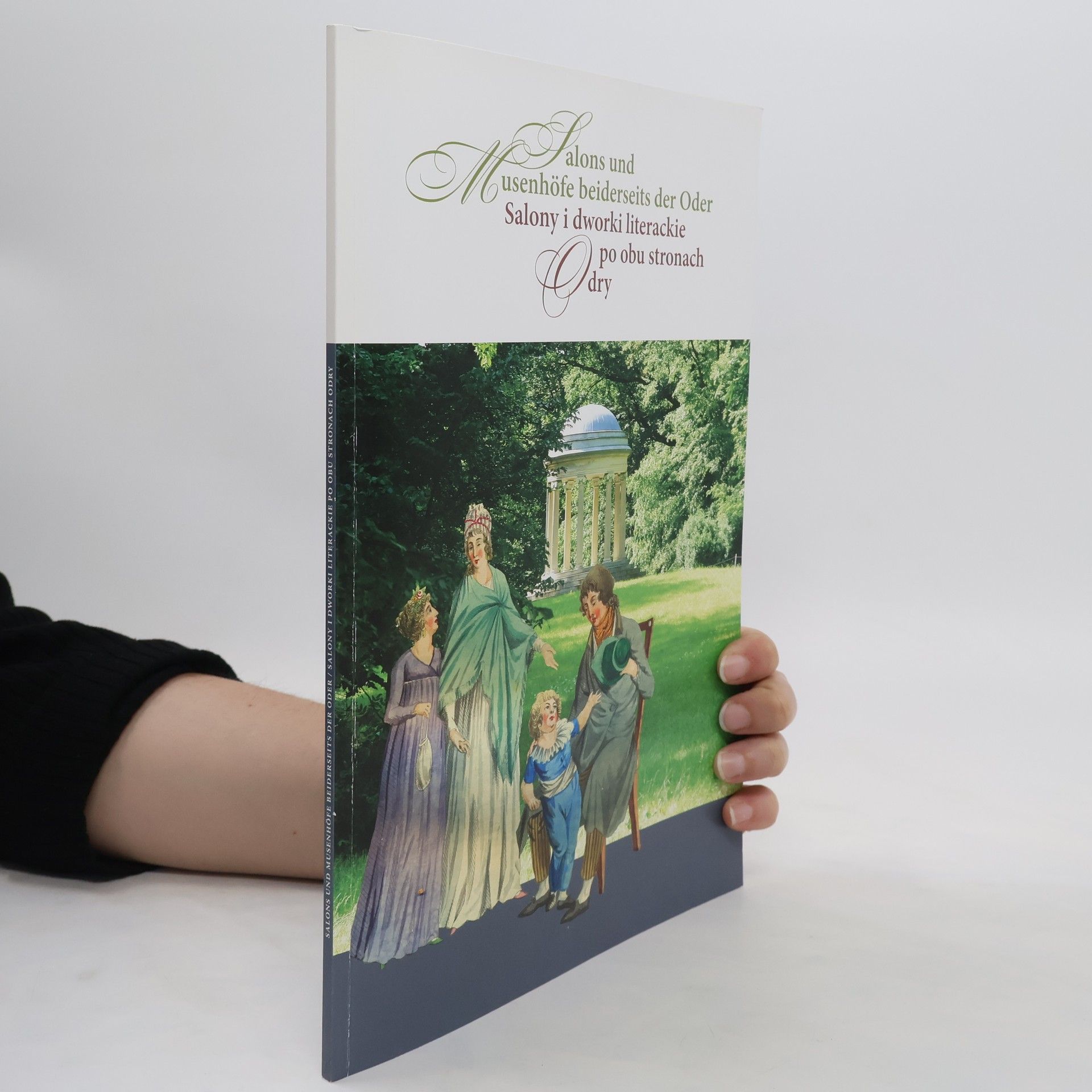
Die Berliner "jüdischen Salons" um 1800 werden als dynamisches und empfindliches Kommunikationsnetz präsentiert. Anhand neuer Quellen wird die Geselligkeitskultur des Jahres 1794/95 beleuchtet, in der unterschiedliche Orte zu Salons wurden und Gäste sowie Gastgeberinnen neu entdeckt werden. Durch detaillierte Rekonstruktionen jahrzehntelanger Korrespondenzen wird untersucht, wie sich die Wahrnehmung jüdischer Gastgeberinnen wandelte und welche Wechselwirkungen zwischen den Salons und den zeitgenössischen Emanzipationsdiskursen bestanden.
Heinrich von Kleists Werke wurden und werden weltweit auf den Theaterbühnen gespielt. Doch was bleibt, wenn der letzte Vorhang gefallen ist? Und was erzählt das, was übrig bleibt? Das Kleist-Museum, Frankfurt (Oder), bewahrt die 'Reste' vieler Inszenierungen, zum Beispiel Bühnenmodelle, Figurinen, Kostüme, Requisiten, Strichfassungen, Plakate, Programmhefte, Kritiken, Szenenfotos. Aber auch immaterielle Hinterlassenschaften wie Erinnerungen von Beteiligten gehören dazu. Theatergeschichten aus 200 Jahren verbergen sich in den Tiefen des Archivs. Der Band versammelt Perspektiven von Theaterschaffenden und Wissenschaftlerinnen auf einzelne Objekte der Theatersammlung des Kleist-Museums. Außerdem enthält er Interviews mit den international arbeitenden Regisseuren Holk Freytag, Matthias Langhoff, Armin Petras und Claus Peymann sowie dem Bühnenbildner Martin Fischer.