Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung des ethnografischen Forschungsansatzes. Es führt in die methodologischen Grundlagen, den Forschungsprozess sowie die konkreten Schritte der Forschungspraxis ein. Die Autoren zeigen, wie sich Ethnografen ihrem Feld annähern, Daten gewinnen und wieder auf Distanz zum Feld gehen, wie sie an Protokollen arbeiten, Überraschungen entdecken, Daten sortieren und Themen entwickeln. Es wendet sich an Studierende der Soziologie, der Ethnologie, der Erziehungswissenschaft, der empirischen Kulturwissenschaft und an alle Sozialwissenschaftler/innen, die Ethnografie treiben wollen. Prof. Dr. Georg Breidenstein ist Erziehungswissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Prof. Dr. Stefan Hirschauer und Prof. Dr. Herbert Kalthoff sind Soziologen an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Jun.-Prof. Dr. Boris Nieswand ist Ethnologe und Soziologe an der Universität Tübingen. Dieser Titel ist auf verschiedenen e-Book-Plattformen (Amazon, Libreka, Libri) auch als e-Pub-Version für mobile Lesegeräte verfügbar.
Georg Breidenstein Knihy
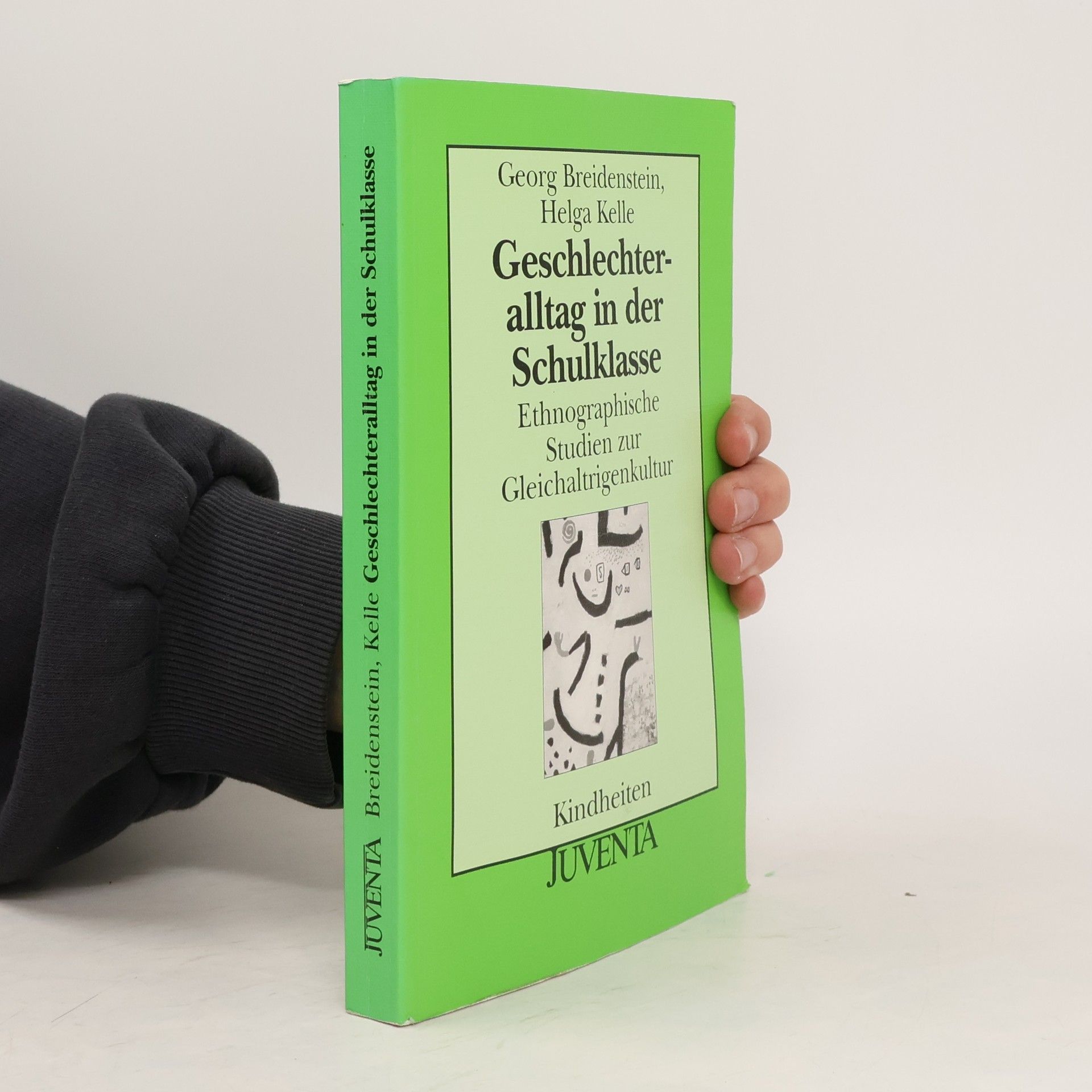


Erziehungspraktiken in der Grundschule
Unterrichtsalltag beobachten und reflektieren
- 250 stránek
- 9 hodin čtení
Die Notwendigkeit und die Grenzen von "Erziehung" im Lehrerhandeln stehen im Mittelpunkt des Buches. Zunächst werden grundlegende erziehungswissenschaftliche Theorien erörtert, gefolgt von einer Analyse von teilnehmenden Beobachtungen an vier unterschiedlichen Grundschulen. Diese exemplarischen Studien bieten Einblicke in die praktischen Herausforderungen und Konzepte der Erziehung im Schulalltag.
Geschlechteralltag in der Schulklasse
- 287 stránek
- 11 hodin čtení
Welchen Gebrauch machen Kinder einer Schulklasse von der Geschlechterunterscheidung? Dieser Frage widmen sich ethnographische Studien, die in diesem Buch versammelt sind. Durch teilnehmende Beobachtungen und ethnographische Interviews untersuchen die Autor:innen die Gleichaltrigenkultur in den Schuljahrgängen 4 bis 6. Im Fokus stehen alltägliche Praktiken wie Ärgern, Lästern, Erzählen und Spielen. Die Schulklasse, als Rahmen dieser Aktivitäten, ist durch gemeinsam verbrachte Zeit, Wissen übereinander und spezifische Öffentlichkeiten geprägt. Die Kapitel bieten eine kulturanalytische Beschreibung zentraler Themen des Schulalltags: Beliebtheit, Freundschaft, Verliebtheit, Sexualität und Entwicklung. Die verbindende Frage ist die Bedeutung der Geschlechterunterscheidung im jeweiligen Kontext. Der Blick wird von den Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen hin zur Praxis der Geschlechterunterscheidung verschoben, um den sozialen Sinn dieser Differenzierung für die Beteiligten zu erfassen. Die Inhalte reichen von der Ordnung der Schulklasse über die Sortierung der Kinder in „Mädchen“ und „Jungen“ bis hin zu Freundschaftsinszenierungen und dem Sexualitätsdiskurs. Zudem werden alltägliche Theorien zur Geschlechterdifferenz und der Entwicklungsdiskurs behandelt, um die Neukodierung kultureller Praktiken zu beleuchten.