Die Arbeit basiert auf weitgehend unbekannten archivalischen Quellen zu Johann Philipp Krieger und seinem Sohn Johann Christian Konrad. Sie zeichnet detailliert den Prozess der Literaturversorgung in Hessen von 1725 bis 1825 nach. Das als Buchhandlung mit Leihbücherei und verschiedenen Journallesezirkeln in der oberhessischen Universitätsstadt Giessen gegründete Familiengeschäft wird zu einem der führenden Buchhandelsunternehmen in Hessen. Die Qualität des Verlagsprogramms und der Produktionsumfang lassen sich mit anderen führenden Buchhändlern der Aufklärung wie z. B. Johann Christian Dieterich in Göttingen vergleichen. J. Chr. K. Krieger deckt den regionalen Lektürbedarf vollständig ab und etabliert sich als renommierter Verleger, gehasster Nachdrucker und als Reformer, der zugleich auf Wirtschaftlichkeit und Rentabilität setzt. Er gründet das erste medizinische Leseinstitut und bindet mit seinen Zeitschriftenprojekten anerkannte Wissenschaftler an den Verlag. Er gibt das erste Branchenblatt der Buchhändler in Deutschland, das „Wochenblatt für Buchhändler, Antiquare, Musik- und Dispütenhändler“, heraus.
Christine Haug Knihy
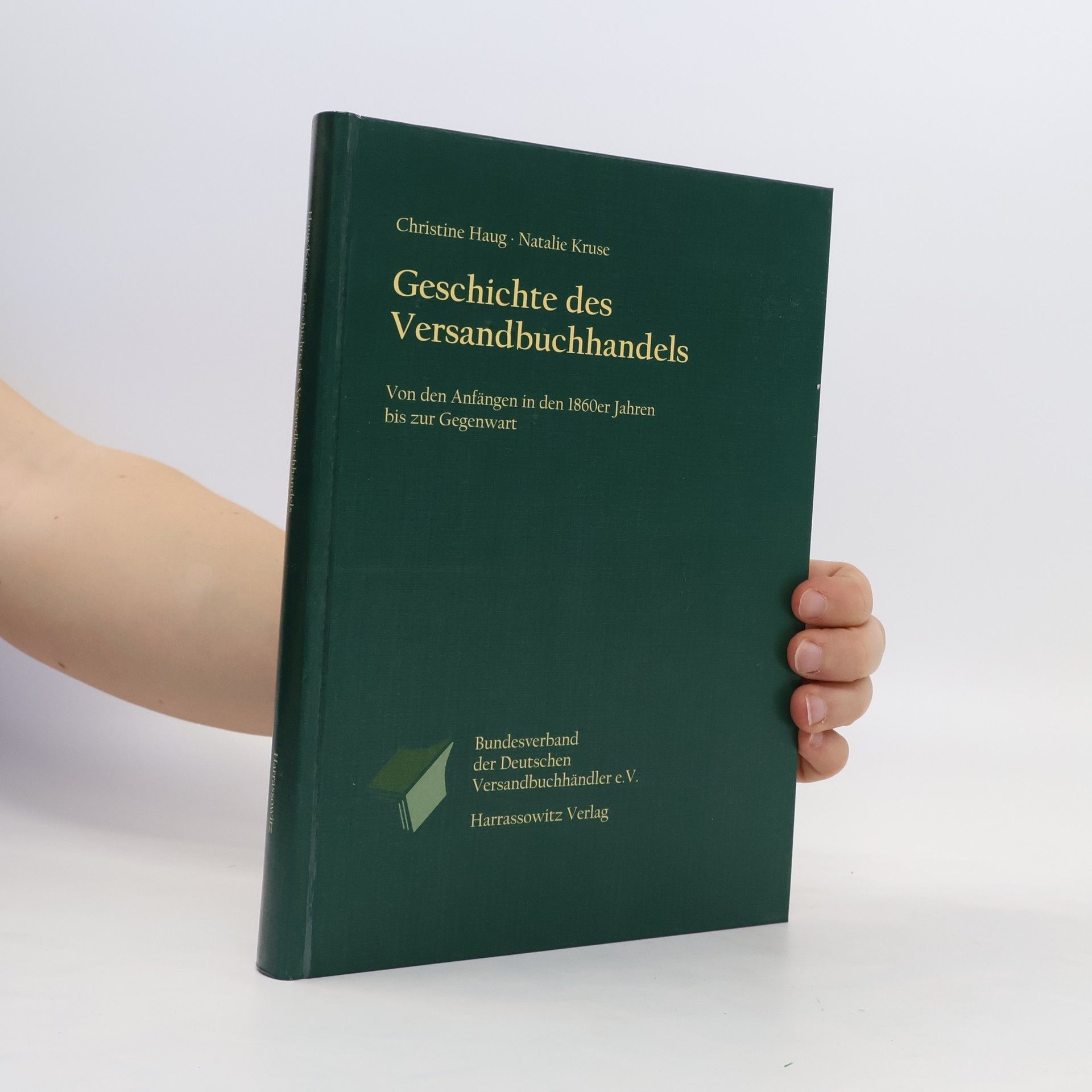
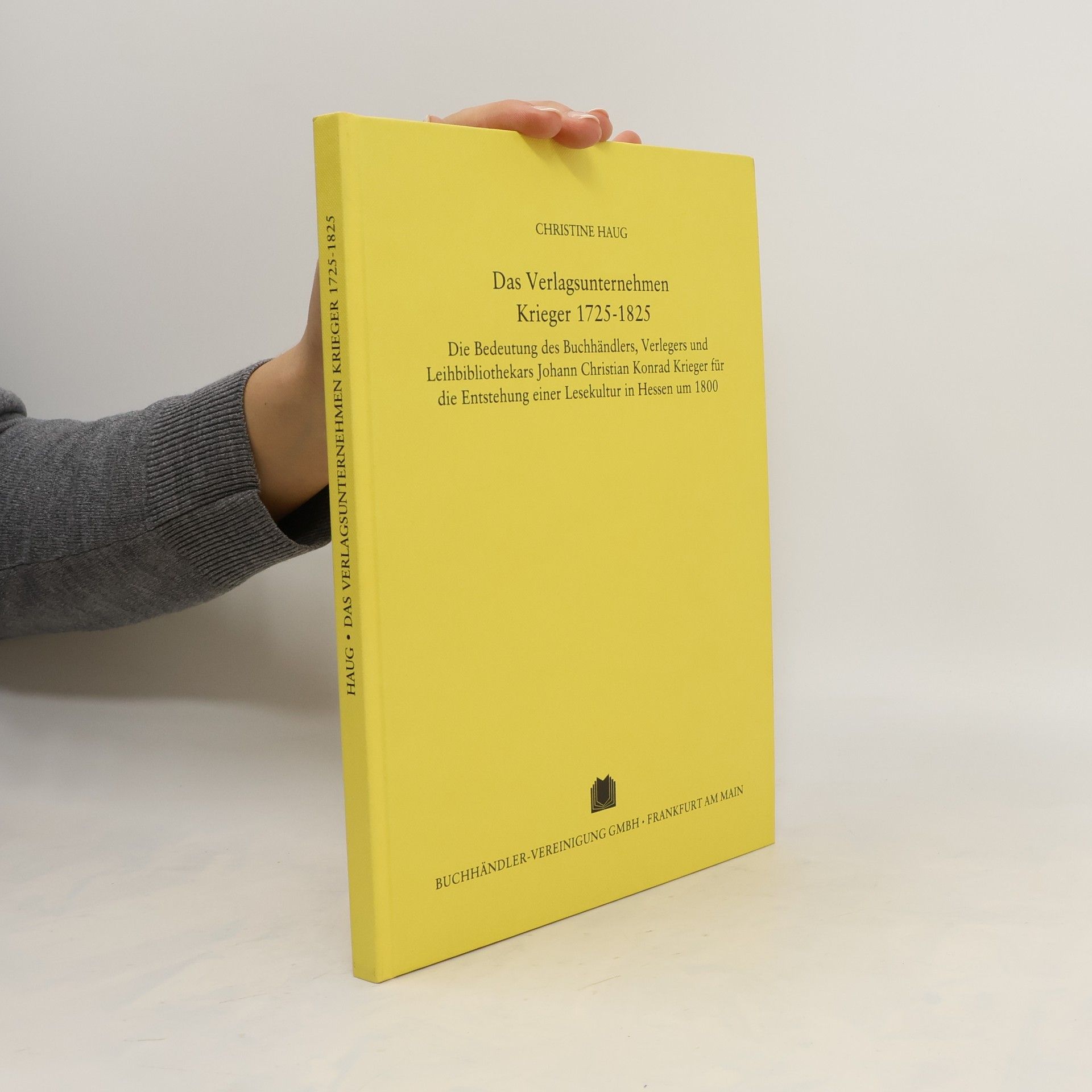
Auf der Grundlage neu erschlossener Quellen, der Auswertung buchhändlerischer Fachzeitschriften und Lehrbücher und nicht zuletzt anhand von Interviews mit Zeitzeugen rekonstruiert die Studie erstmals die Entstehung und Entwicklung des Versandbuchhandels von seinen Anfängen in den 1860er Jahren bis in die Gegenwart. Herausgeber dieser Arbeit ist der 1901 gegründete Bundesverband der Versandbuchhändler, eine eigenständige Berufsorganisation, welche die Interessen der Branche vertritt. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Kommerzialisierung des Literaturbetriebs und der Einführung neuer Versandformen im Postverkehr etablierte sich der Reise- und Versandbuchhandel in den 1860er Jahren als selbständiger Geschäftszweig des verbreitenden Buchhandels. Seine wechselvolle Geschichte ist auch ein Spiegel der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland: Vom Kaiserreich zur Berliner Republik, von der Industrialisierung zum Internet, das der Branche nachhaltigen Auftrieb beschert hat.