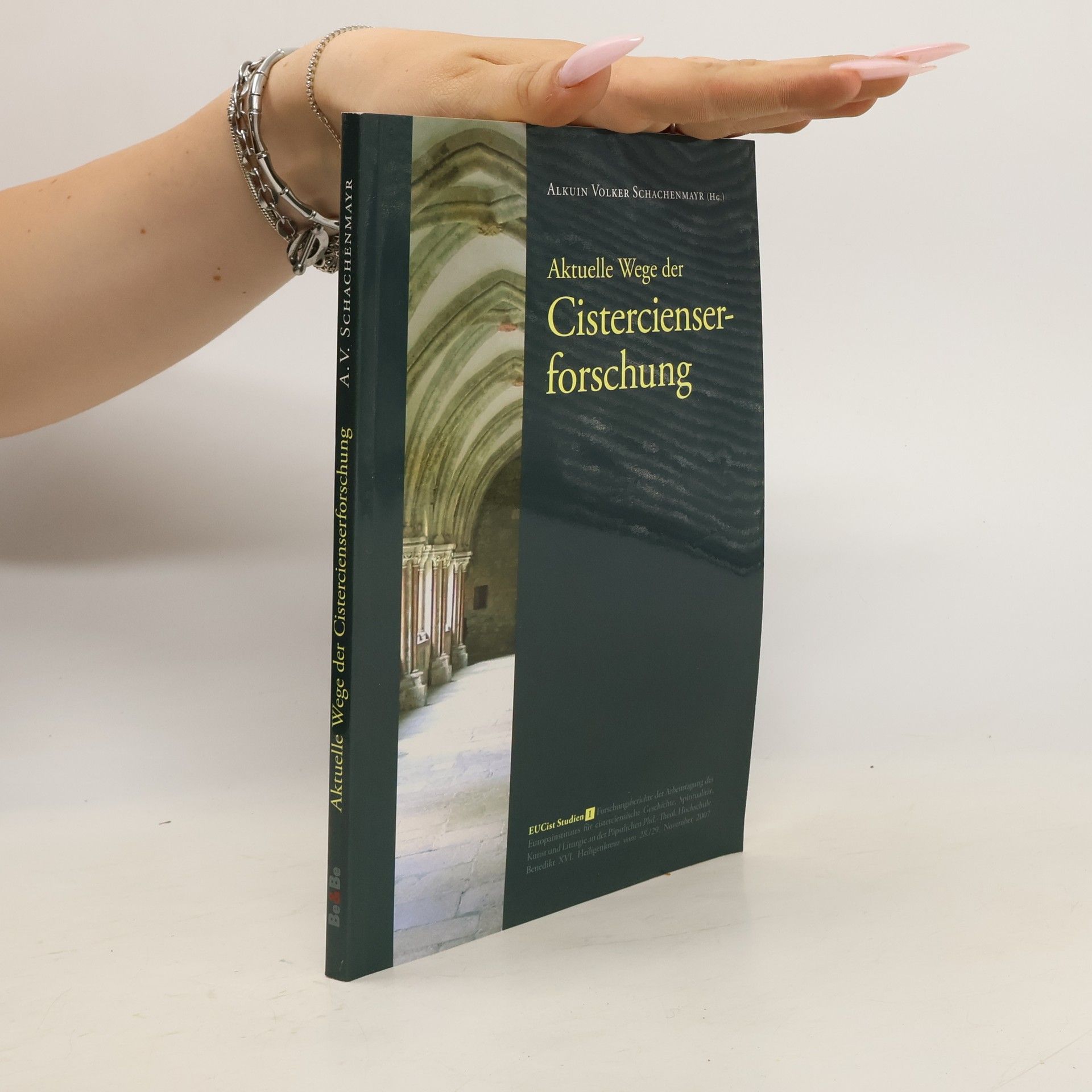Sterben, Tod und Gedenken in den österreichischen Prälatenklöstern der Frühen Neuzeit
Habilitationsschrift
- 363 stránek
- 13 hodin čtení
Der Umgang mit dem Sterben und den Gestorbenen kann sich von einer Generation zur nächsten radikal verändern. In keinem Punkt scheint uns die Barockzeit so fremd wie im Umgang mit dem Tod. Beinahe jedes Barockkloster errichtete eine neue Totenkapelle, in der Leichen und Knochen zum Betrachtungsstoff wurden. Die Mönche fürchteten die Majestät des Todes, doch suchten sie zugleich Vertrautheit mit ihm: Er war ihnen Herrscher und Freund, Bedrohung und Trost zugleich. Dieses Buch führt in die klösterliche Sachkultur rund um das Thema Tod ein: vom Tod des Mönches als Rechtsperson bei der Einkleidung über das Meditatorium, in die Infirmarie, an das Sterbebett und in die Gruft. Ebenso schildert der von der Theaterwissenschaft kommende Verfasser die reiche Gedächtniskultur der Klöster mit ihren Prozessionen, Kerzenordnungen und feierlichen Todesanzeigen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der gewöhnliche Mönch aus der Sicht der Frömmigkeits- und Observanzgeschichte. Direkte und unkomplizierte Bestellung unter: bestellung(at)klosterladen-heiligenkreuz. at