This is the most authoritative and comprehensive guide ever published to the state of the art in philosophy of mind, a flourishing area of research. An outstanding team of contributors offer 45 new critical surveys of a wide range of topics.
Sven Walter Knihy
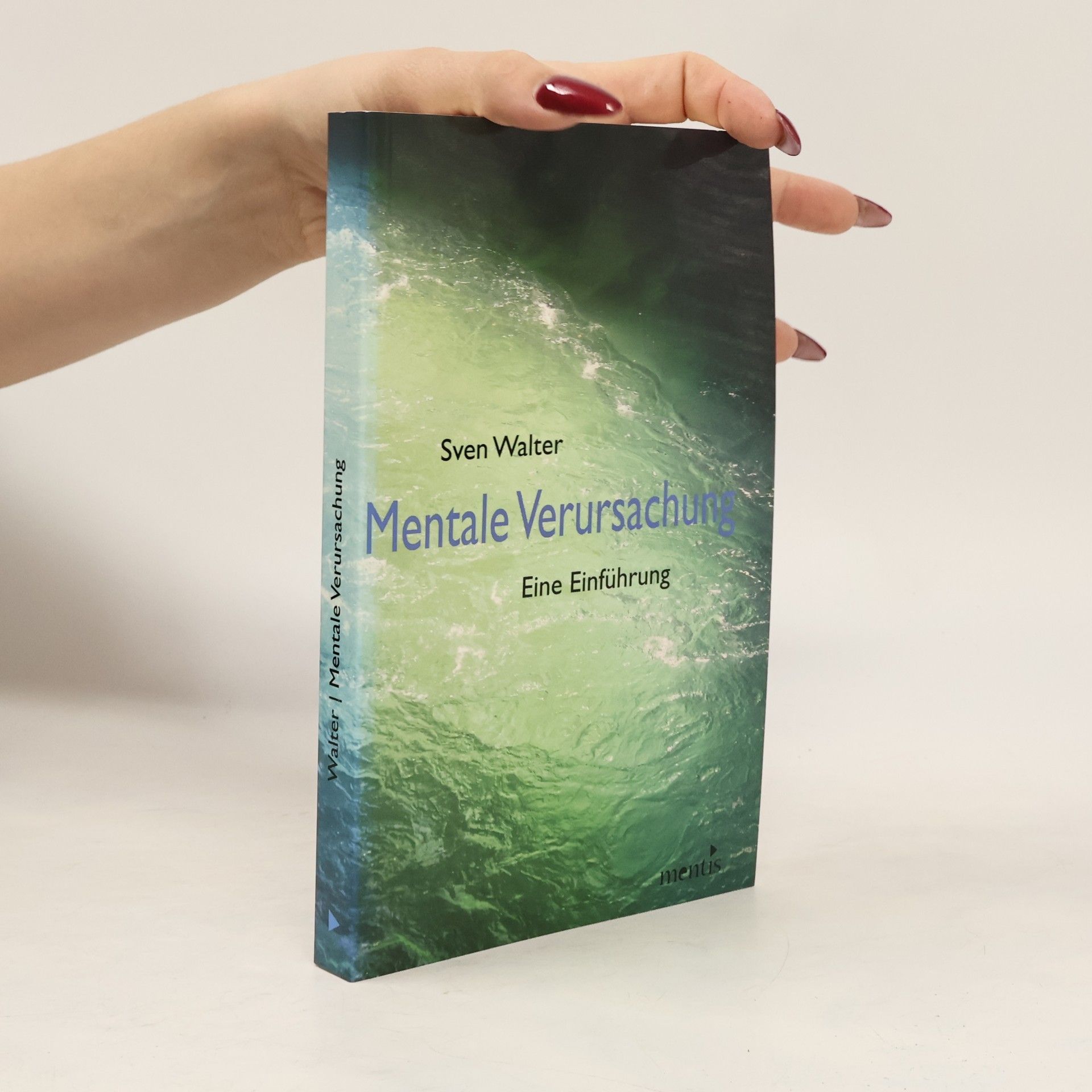
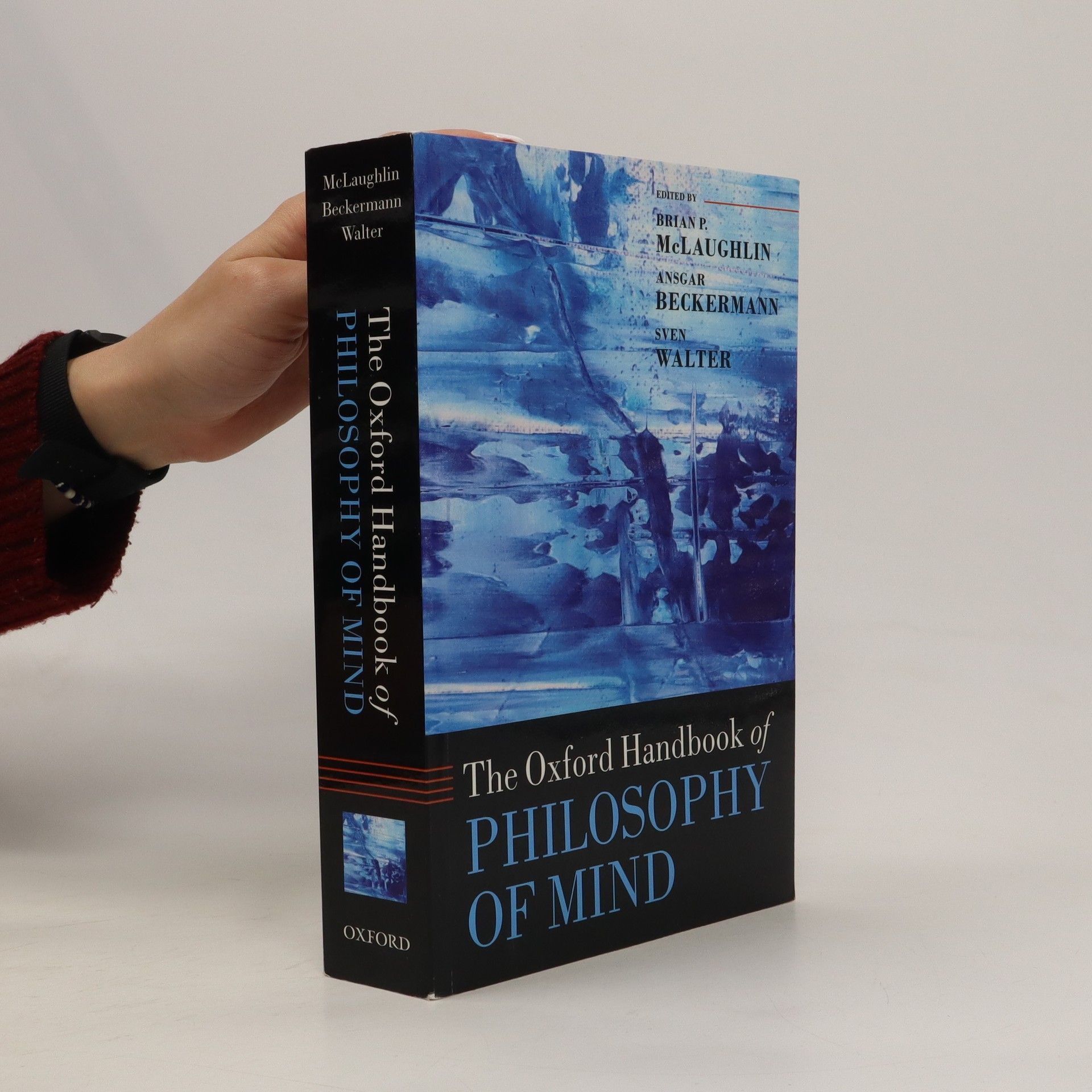
Mentale Verursachung
Eine Einführung
Der Ausdruck 'mentale Verursachung' beschreibt die alltägliche kausale Interaktion zwischen bewussten Subjekten und der umgebenden Welt: Ein scharfer Schmerz lässt uns aufstöhnen, eine peinliche Situation führt zum Erröten, und die Wahrnehmung eines alten Freundes lässt unseren Arm zum Gruß heben. Es scheint offensichtlich, dass mentale Verursachung existiert. Doch wie kann unser Geist kausalen Einfluss auf unseren Körper und damit auf die physikalische Realität ausüben? Seit Descartes bemüht sich die Philosophie um eine Theorie, die erklärt, wie das Mentale in die physikalische Wirklichkeit integriert ist und deren Verlauf beeinflussen kann. Ob die Frage nach dem Wie der mentalen Verursachung jemals zufriedenstellend beantwortet werden kann oder ob wir uns von etwas vermeintlich Offensichtlichem verabschieden müssen, bleibt ungewiss. Diese Einführung beleuchtet die verschiedenen Facetten der mentalen Verursachung, präsentiert Lösungsvorschläge und regt zur eigenständigen Auseinandersetzung mit dem 'Problem der mentalen Verursachung' an. Sie zeigt, warum dieses Thema ein spannendes philosophisches Problem darstellt.