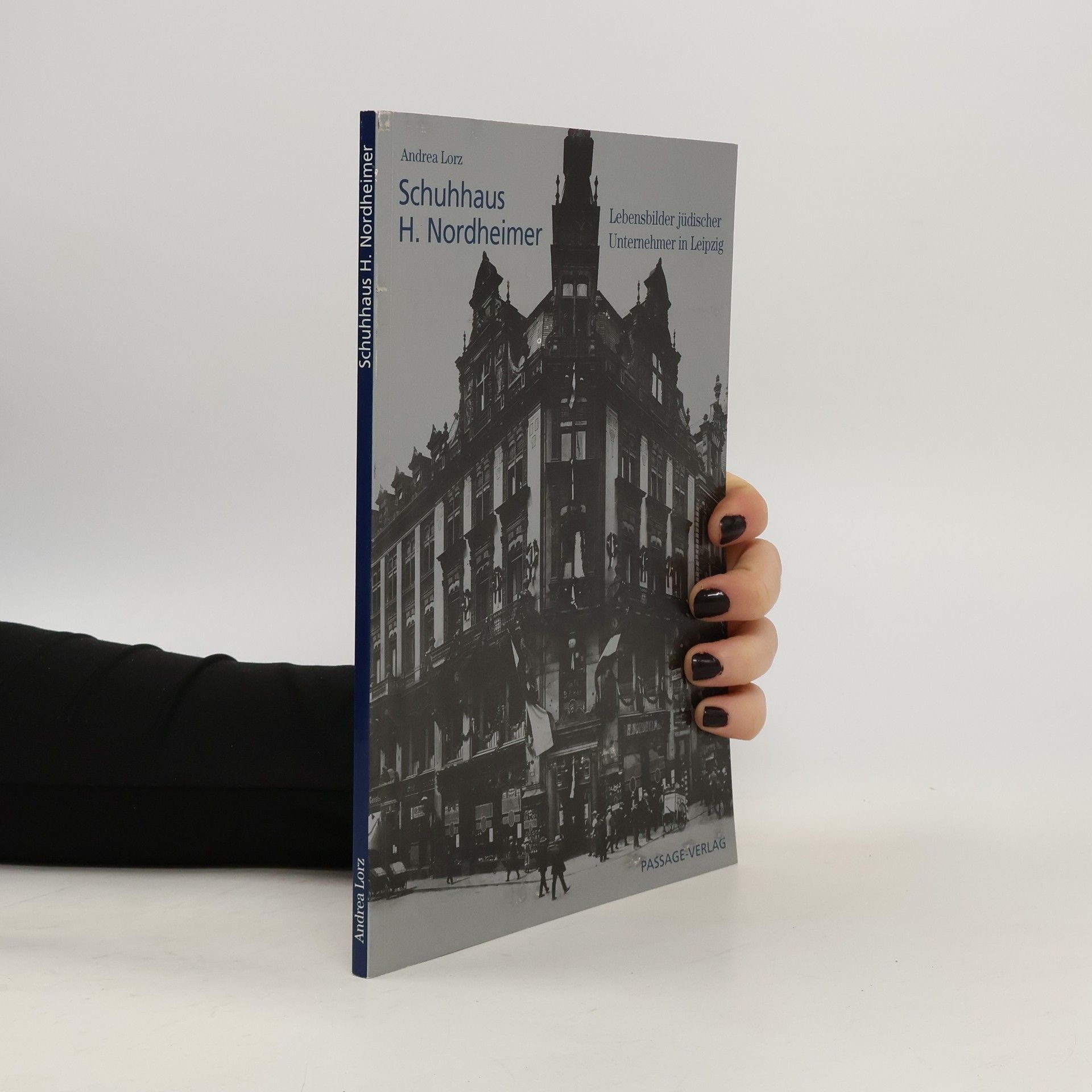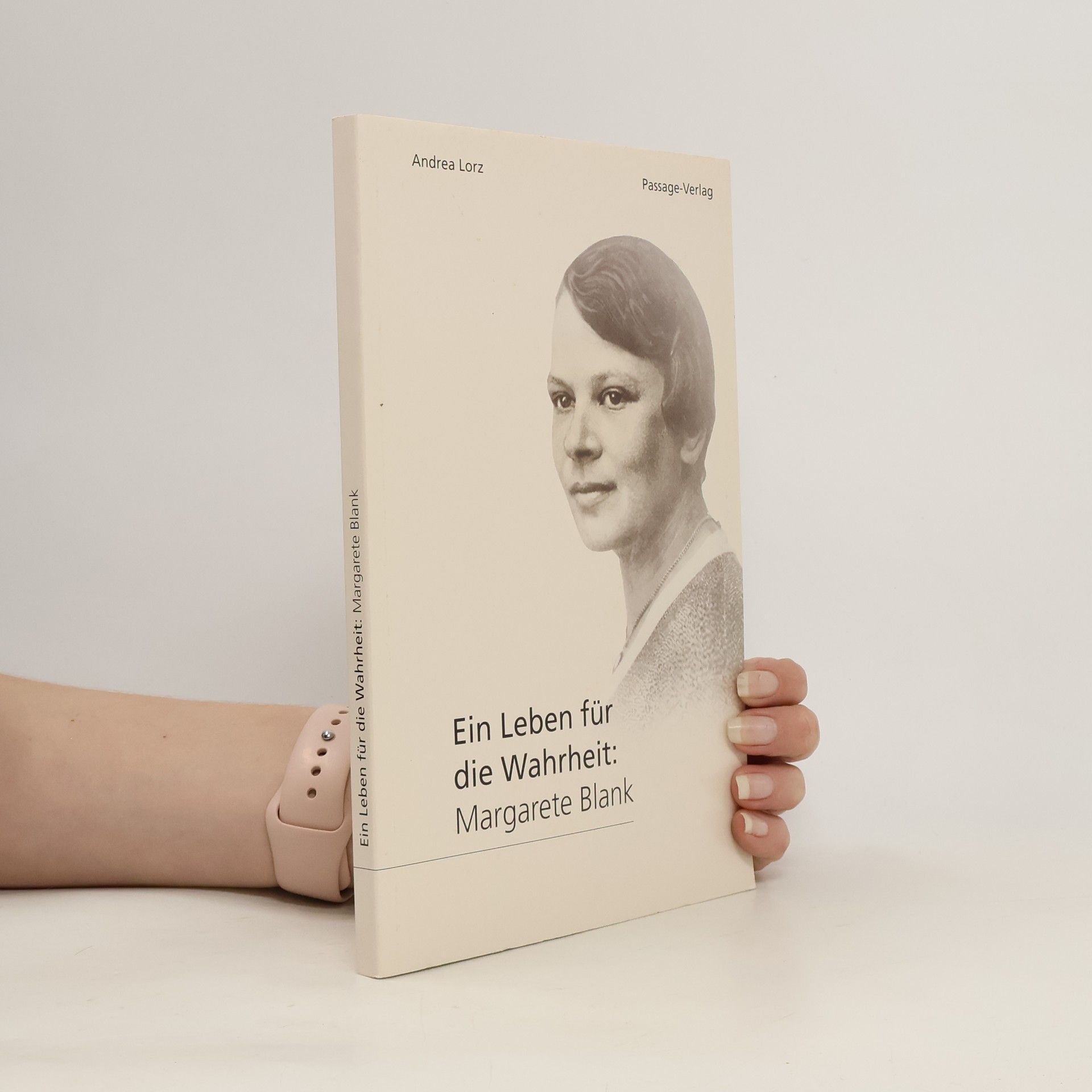Rosalie Ruscha Cohn
Eine Leipziger Überlebensgeschichte
Rosalie R. Cohn, geb. Jacobowitz, wurde im April 1870 in Adelnau/Posen als zweites von drei Kindern einer Kaufmannsfamilie geboren. Sie besuchte die Schule in ihrem Geburtsort und heiratete 1894 den Kaufmann Hermann Cohn aus Jessnitz. Weitere Lebensstationen der Cohns wurden nun Greiz, wo auch ihre beiden Töchter geboren wurden, und Leipzig. Der Tod ihres Mannes im Jahr 1923 stellte einen ersten tragischen Einschnitt in ihrem Leben dar. Im September 1942 gehörte die 72-jährige Rosalie R. Cohn zu den jüdischen Leipzigern, die von Leipzig nach Theresienstadt deportiert wurden. Am 8. Mai 1945 erlebte sie die Befreiung des Lagers durch die Rote Armee. Sie zählte, neben drei Enkelkindern, die durch den Kindertransport nach England gerettet wurden, zu den einzigen Überlebenden ihrer Familie. Im Juli 1945 kehrte sie nach Leipzig zurück und verstarb hier im Jahre 1959.