Salzburger Jahrbuch für Philosophie 67 / 2022
Natur und Kultur - ein Verhältnis in der Krise?
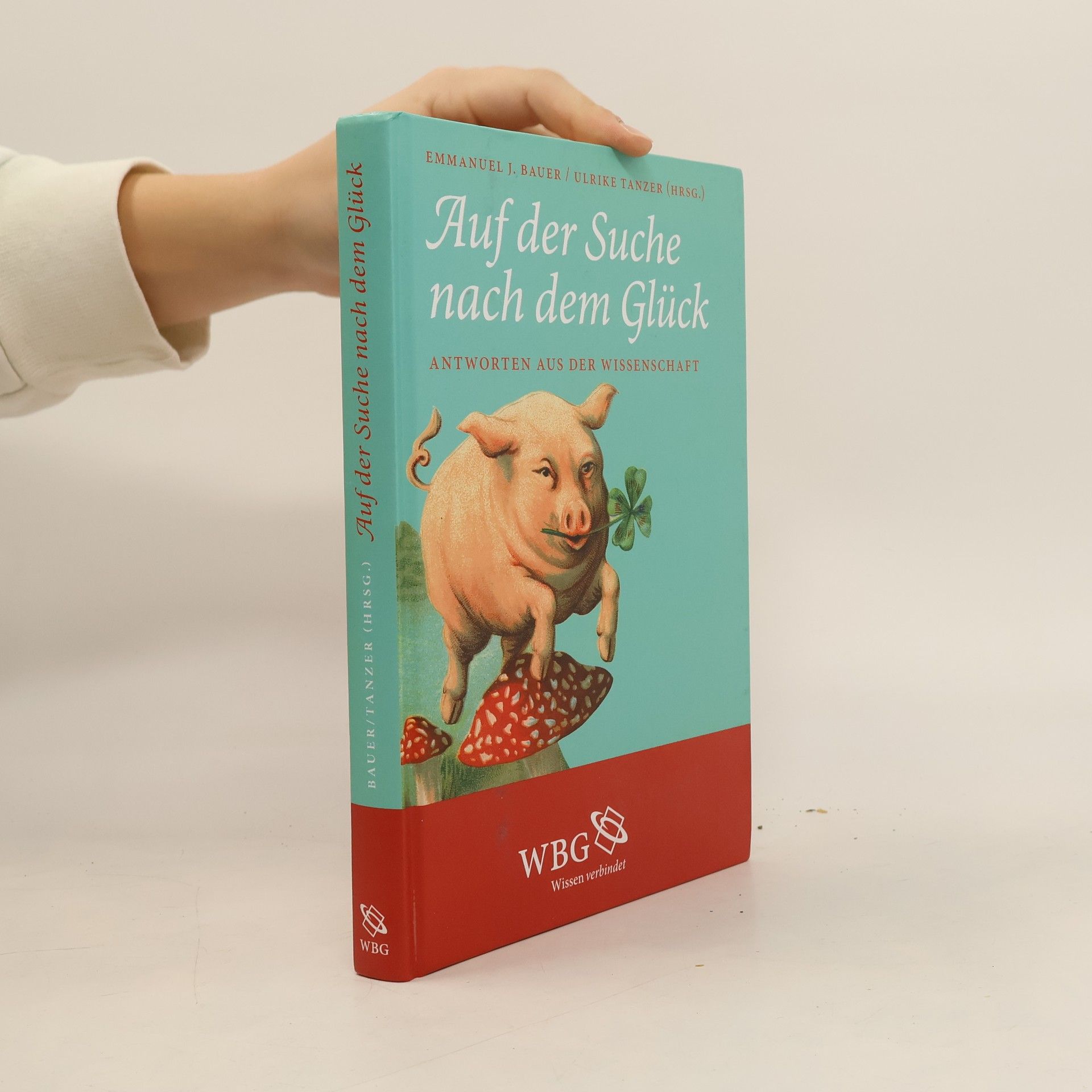

Natur und Kultur - ein Verhältnis in der Krise?
Glücklich zu sein ist wohl das tiefste und umfassendste Verlangen des Menschen. Alles, was wir sind, denken, fühlen und tun, schöpft letztendlich aus dem erhofften Glück seine Dynamik und Orientierung. Dennoch kann Glück nicht das unmittelbare Ergebnis unseres Denkens, Wollens, Planens und Machens sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht doch sehr viel dazu beitragen können, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Gibt es so etwas wie Talent zum Glück oder eine Kunst des richtigen Lebens? Worauf kommt es an? Der Band beleuchtet die Frage nach dem Glück aus verschiedenen Perspektiven (Philosophie, Wirtschaft, Psychologie, Quality-of-Life-Forschung, Genetik, Pädagogik, Theologie, Politik, Literatur und Kunst), benennt individuelle, strukturelle und soziale Bedingungen des Glücks in verschiedenen Lebenskontexten und zeigt nicht zuletzt konkrete Wege zum Glück auf.