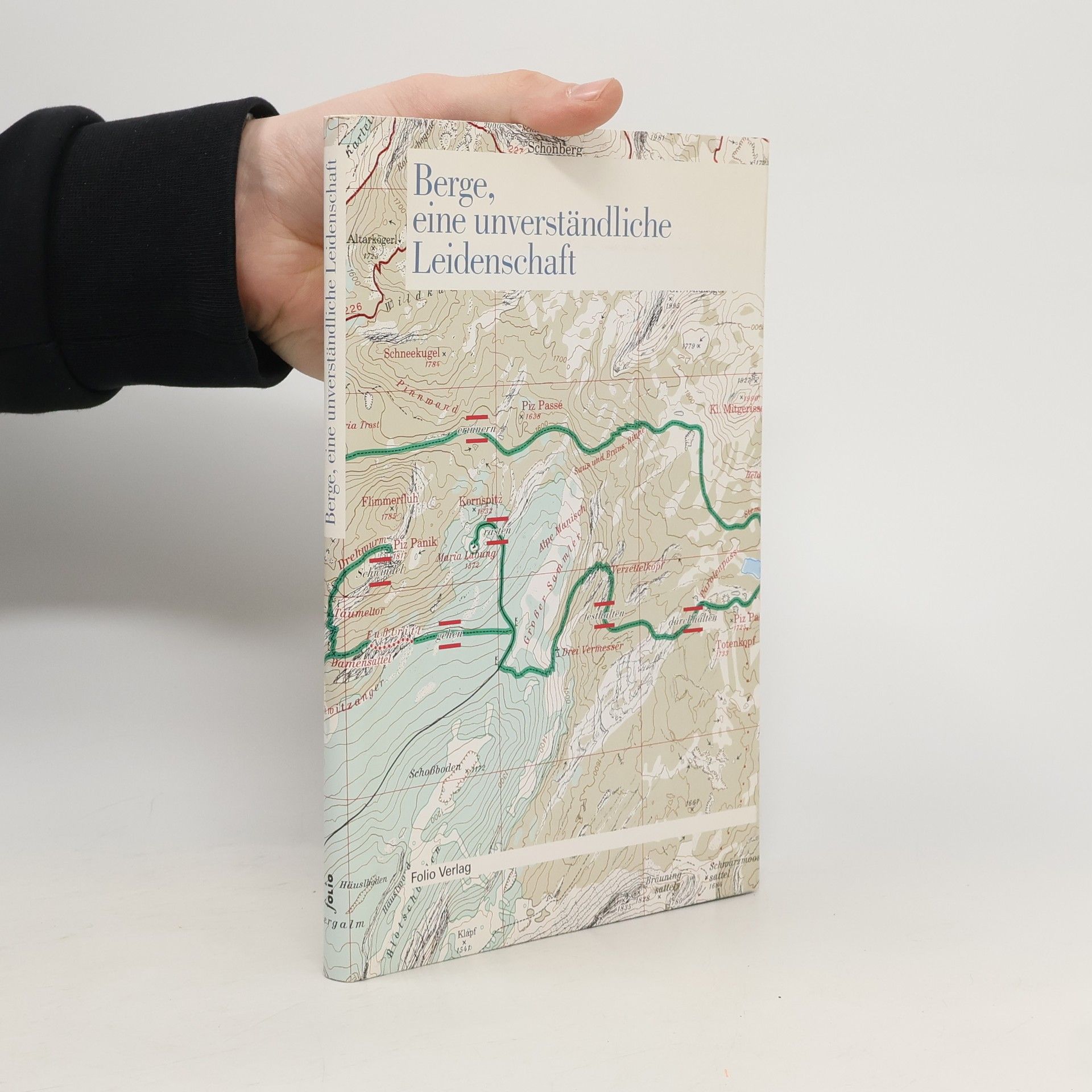"The story of how the German Left fell in love with theory"-- Provided by publisher
Philipp Felsch Knihy
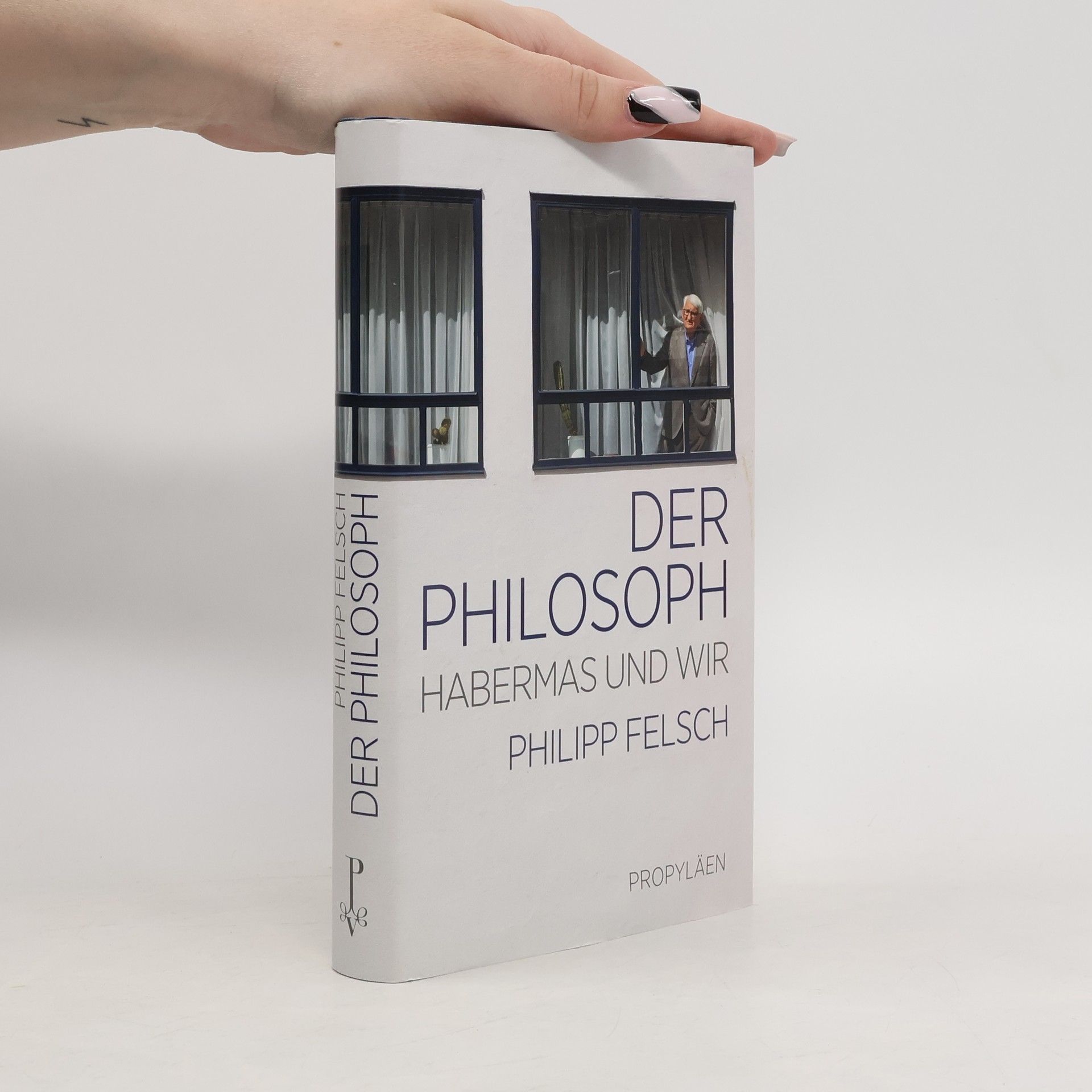
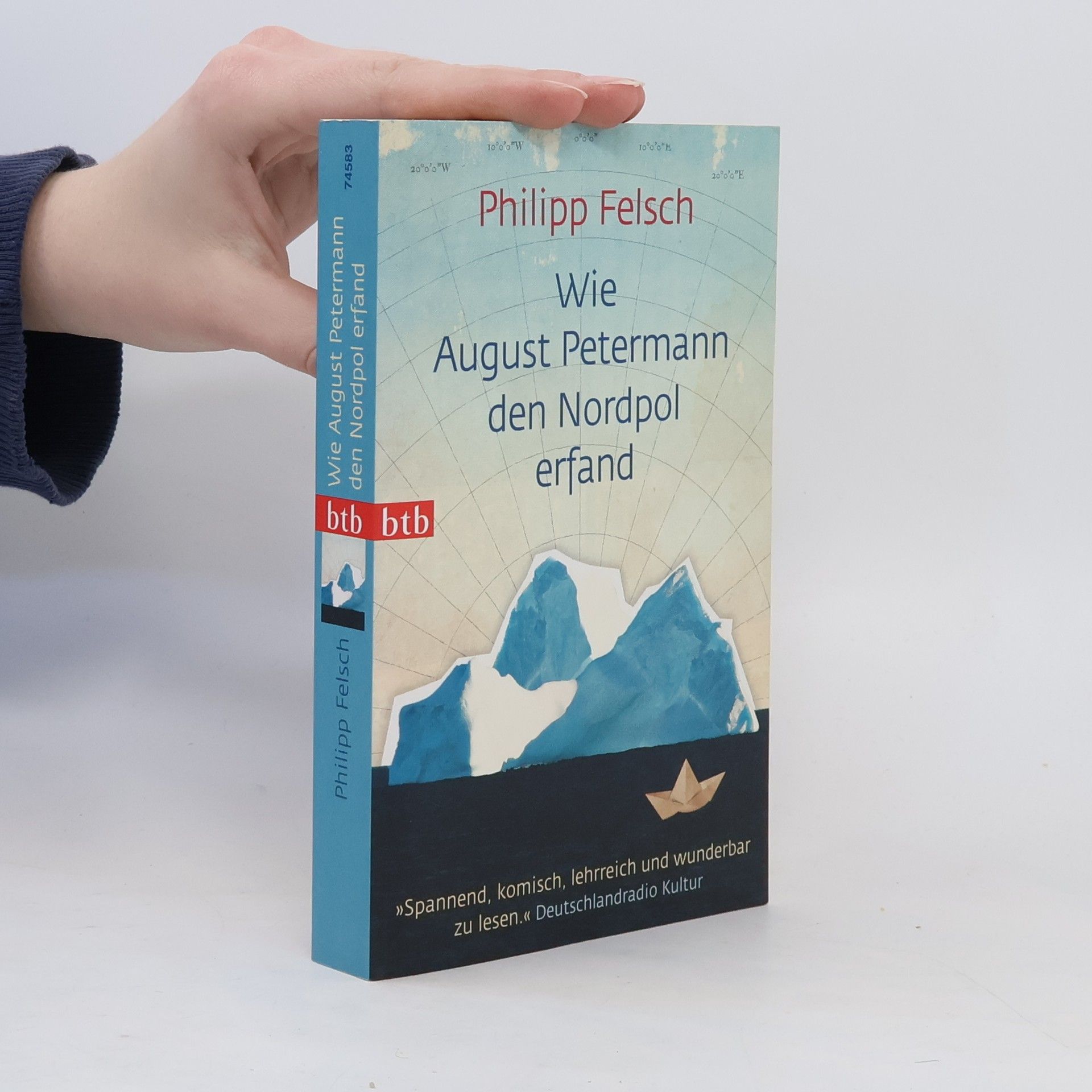

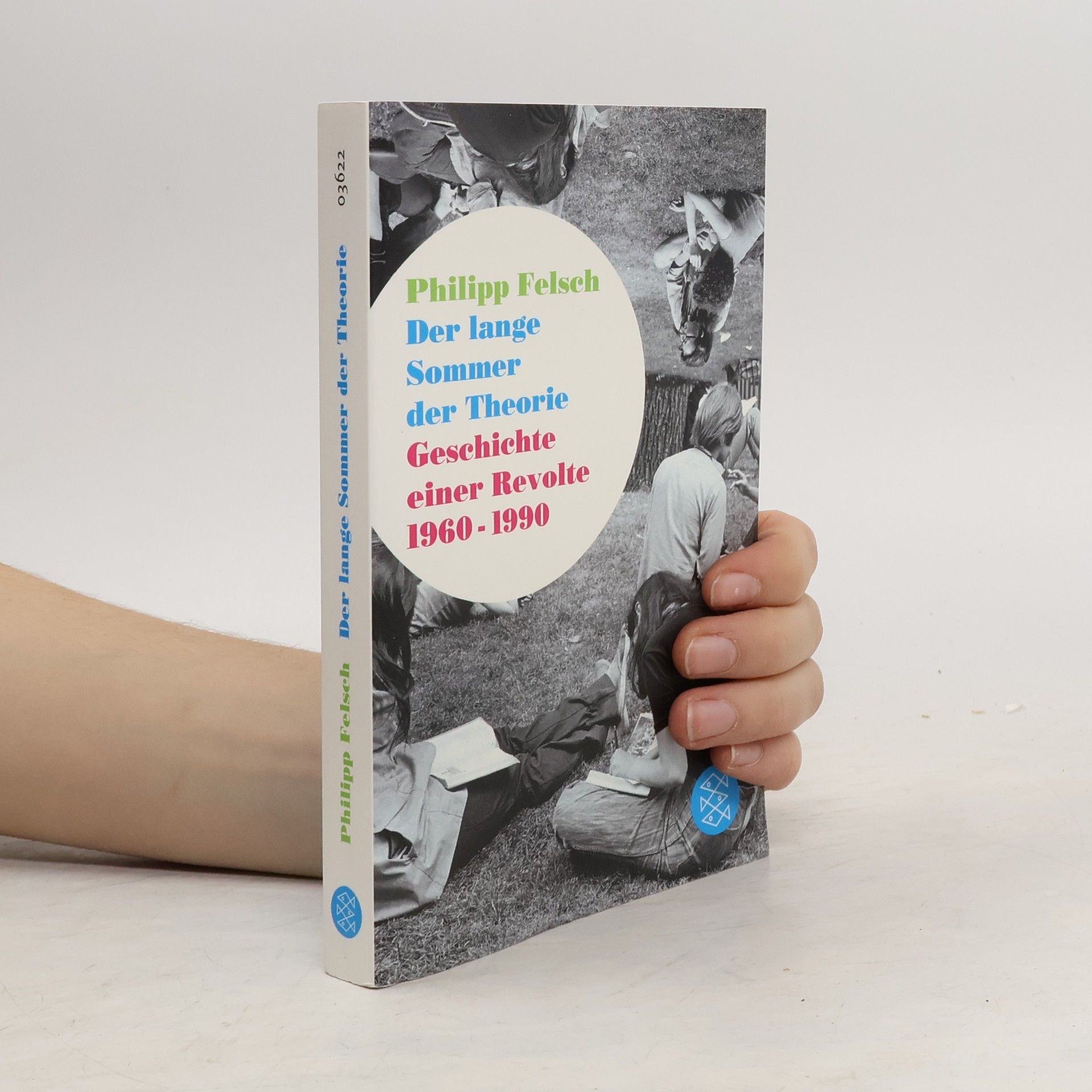


Nietzsche’s reputation, like much of Europe, lay in ruins in 1945. Giving a platform to a philosopher venerated by the Nazis was not an attractive prospect for Germans eager to cast off Hitler’s shadow. It was only when two ambitious antifascist Italians, Giorgio Colli and Mazzino Montinari, began to comb through the archives that anyone warmed to the idea of rehabilitating Nietzsche as a major European philosopher. Their goal was to interpret Nietzsche’s writings in a new way and free them from the posthumous falsification of his work. The problem was that 10,000 barely legible pages were housed behind the Iron Curtain in the German Democratic Republic, where Nietzsche had been officially designated an enemy of the state. In 1961, Montinari moved from Tuscany to the home of actually existing socialism to decode the “real” Nietzsche under the watchful eyes of the Stasi. But he and Colli would soon realize that the French philosophers making use of their edition were questioning the idea of the authentic text and of truth itself. Felsch retraces the journey of the two Italian editors and their edition, telling a gripping and unlikely story of how one of Europe’s most controversial philosophers was resurrected from the baleful clutch of the Nazis and transformed into an icon of postmodern thought.
Der lange Sommer der Theorie
Geschichte einer Revolte 1960 bis 1990
Der bekannte Historiker Philipp Felsch folgt in seiner grandios geschriebenen und hochgelobten Kultur- und Geistesgeschichte ›Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte 1960 bis 1990‹ den Hoffnungen und Irrwegen einer Generation, die sich in den Dschungel der schwierigen Texte begab. In Westberlin versorgte der Merve Verlag die Studenten, Spontis und Punks bis zu den Avantgarden des Kunstbetriebs mit ihrer Ration von wildem Denken. Philipp Felsch schreibt die Geschichte einer geistigen Revolte, indem er den Abenteuern der Büchermacher und ihres Umfelds folgt. Er lässt eine Epoche wiederauferstehen, in der das Denken noch geholfen hat. Ein elegant geschriebenes Stück (west-)deutscher Kultur- und Geistesgeschichte.
NIETZSCHE ZWISCHEN DEN FRONTEN DES 20. JAHRHUNDERTS - EINE RASANTE GESCHICHTE
Wie eine falsche Karte den Wettlauf zum Nordpol auslöst – und wie ein Kartograf an der rauen Wirklichkeit scheitert. Der Nordpol: Ort der Sehnsucht und Entdeckerlust für das 19. Jahrhundert. Ein Deutscher will bei diesem Abenteuer mit dabei sein: der genialische Kartenzeichner August Petermann. Die Engländer reiben sich erstaunt die Augen, als ein Bücherwurm, der noch nie einen Eisberg gesehen hat, ihnen erklärt, wo sich – »ernsthaften und besonnenen Berechnungen« zufolge – der für verschollen erklärte John Franklin aufhalten muss. Als die Seeoffiziere sich gegen Petermanns Theorien wehren, zieht er sich tief enttäuscht nach Gotha in Thüringen zurück. Dort erobert Petermann den Nordpol auf dem Papier. Und schickt zahlreiche Expeditionen in die Irre, weil er von seiner – falschen – Theorie partout nicht lassen will …
Der Philosoph
Habermas und wir | Ein neuer Blick auf einen der weltweit einflussreichsten Intellektuellen der Nachkriegszeit
Das intellektuelle Gesicht einer EpocheSolange Philipp Felsch zurückdenken kann, war Jürgen Habermas around: als mahnende Stimme der Vernunft, als Stichwortgeber der Erinnerungskultur, als Sohn der Nachbarn seiner Großeltern in Gummersbach.Neigt sich die intellektuelle Lufthoheit des Philosophen heute ihrem Ende zu, oder bekommen seine Ideen in der Krise unserer »Zeitenwende« neue Brisanz?Felsch liest in einem kaum zu überblickenden Oeuvre nach, folgt dessen Autor in die intellektuelle Kampfzone der Bundesrepublik und fährt nach Starnberg, um Habermas zum Tee zu treffen. Dabei entsteht nicht nur das Porträt eines faszinierend widersprüchlichen Denkers, sondern auch der Epoche, der er sein Gesicht verliehen hat.
Berge, eine unverständliche Leidenschaft
Buch zur Ausstellung des Alpenverein-Museums in der Hofburg Innsbruck
- 179 stránek
- 7 hodin čtení