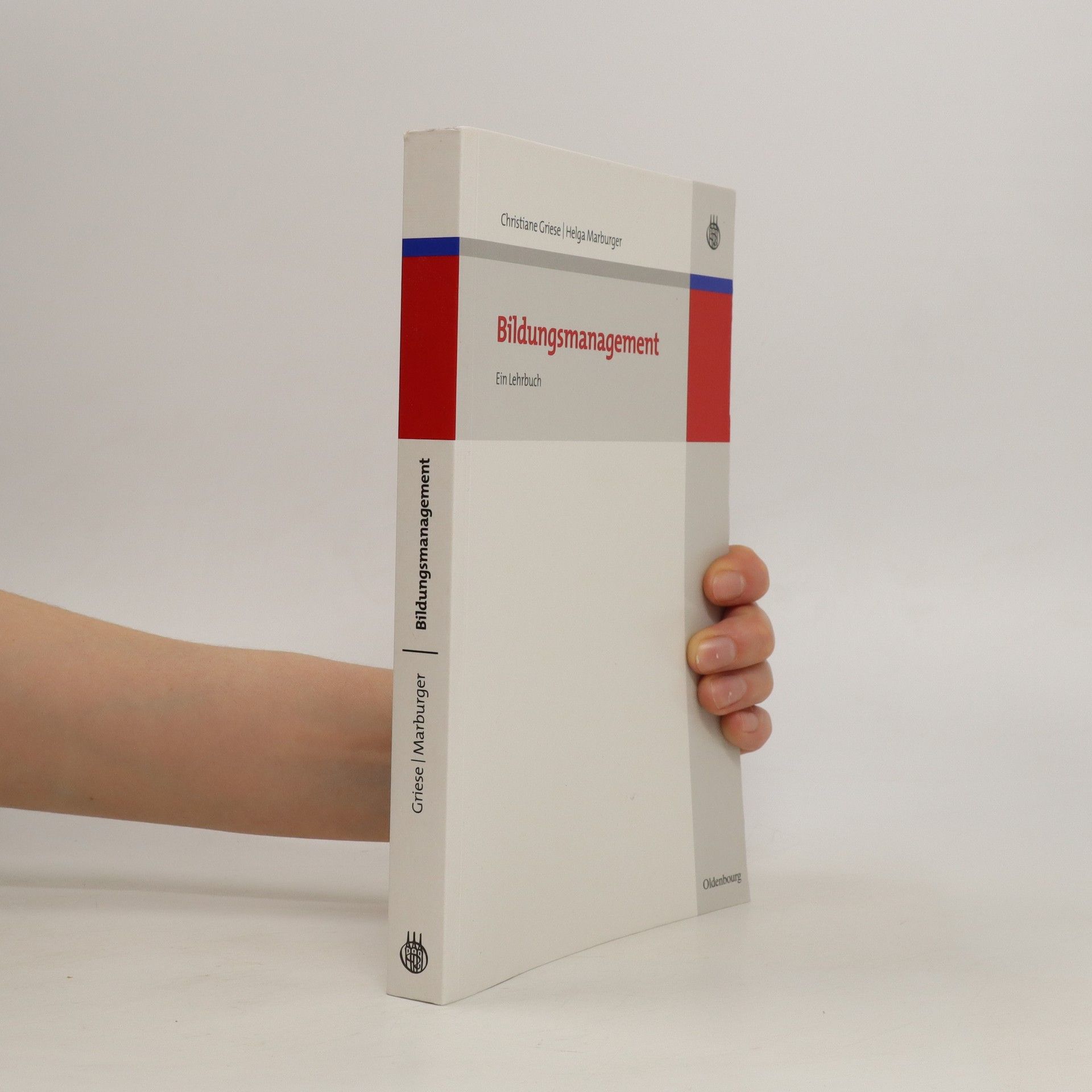Bildungsmanagement
Ein Lehrbuch
Prozesse der Entwicklung sowie Etablierung von neuen Steuerungsstrukturen und -instrumenten im Bereich Bildung haben sich enorm verstärkt. Außerdem lässt sich ein Trend zur Ökonomisierung von Bildungsprozessen erkennen, was sich u. a. darin zeigt, dass die Qualität von Bildungsangeboten auch unter Effizienzgesichtspunkten bewertet wird. Daraus entstand das Bedürfnis nach der Konzeptionalisierung von Bildungsmanagement. Dies bedeutet, Lehr- und Studieninhalte aus der (klassischen) Erziehungswissenschaft bzw. Bildungsforschung mit jenen der (klassischen) BWL zu verknüpfen. Genau jene Verknüpfungs- bzw. Transferleistung ist bisher noch nicht in einem Kompendium für Studium und Lehre geleistet worden. Das Lehrbuch reagiert auf diesen Bedarf und vermittelt in drei Hauptteilen zuerst disziplinübergreifend theoretische Grundlagen und Grundbegriffe. Darauf aufbauend werden Managementfunktionen bzw. Instrumente im Bildungssektor differenziert nach Handlungsfeldern domänenspezifisch erfasst und beschrieben (Finanzierung, Bildungsbedarfsanalyse, Marketing, PR, Networking, Wissensgenerierung und -transfer, Personalführung und -entwicklung, Schulentwicklung Controlling, Evaluation, Qualitätssicherung). Im dritten Teil präsentieren exemplarische Fallstudien (Cases) die Vielfältigkeit und Komplexität von Managementaufgaben bzw. -prozessen in unterschiedlichen Bildungssegmenten sowohl im Profit- als auch Non-Profit-Bereich.