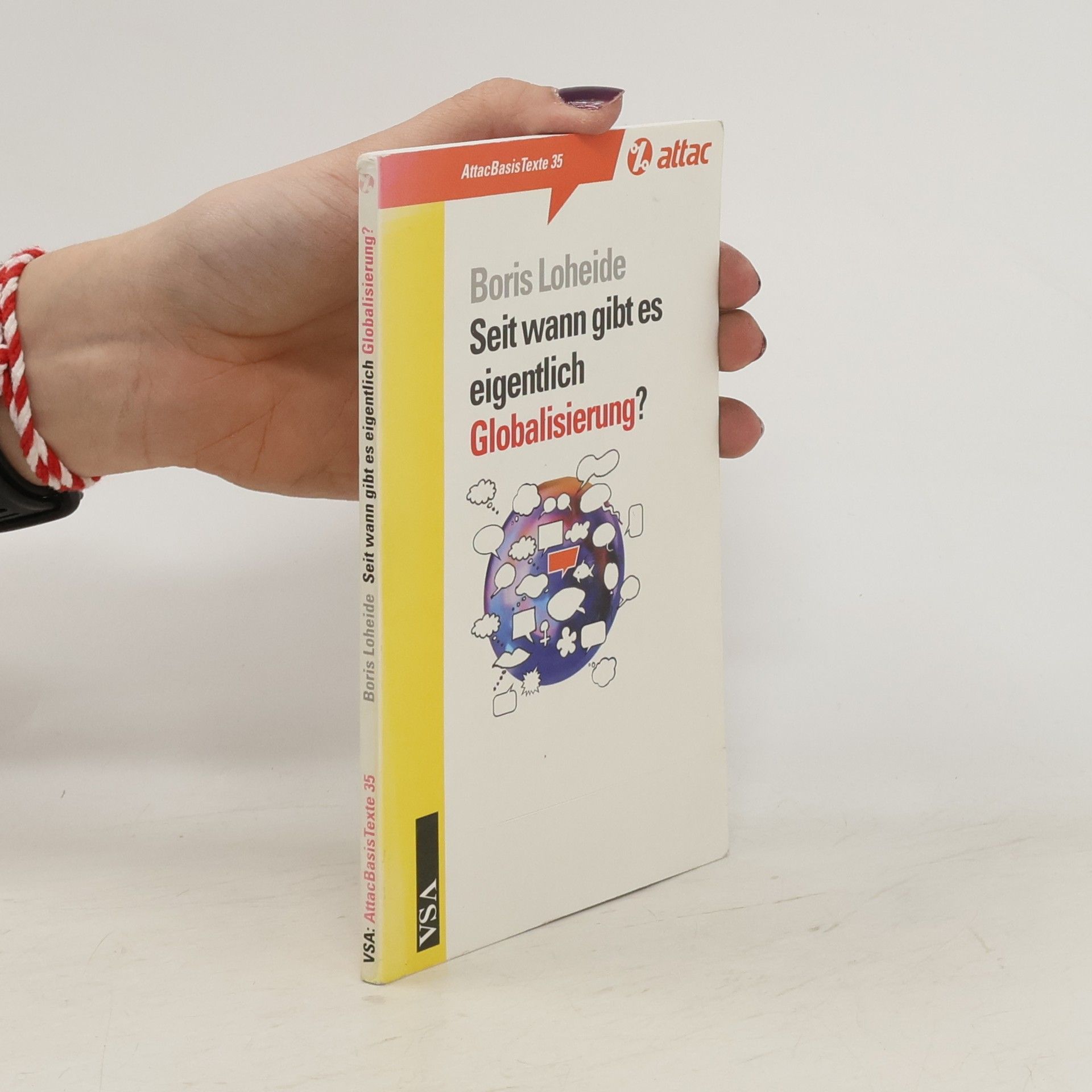Unter WirtschaftshistorikerInnen wird intensiv diskutiert, wann die Globalisierung begann. Theorien von Adam Smith, Friedrich List und Karl Marx prägen diese Debatte bis heute. Die Entstehungsgeschichte von Oppositionsbewegungen gegen die Globalisierung bietet wichtige Lehren. Es wird betont, dass Kritik an Armut und sozialer Ungerechtigkeit nicht zu einem Rückzug in die eigene Nation führen darf. Eine fundierte Kritik an der neoliberalen Globalisierung muss sich klar von der Globalisierungsgegnerschaft rechtspopulistischer und faschistischer Bewegungen abgrenzen. Ausgrenzung und Abschottung sind keine Lösungen, sondern führen in die Katastrophe. Die Diskussion unter WirtschaftshistorikerInnen beleuchtet, ob die Globalisierung eine längere Geschichte hat und wann sie begann. In einem Attac-Basistext werden verschiedene Ansätze vorgestellt. Die Vorstellung, die Globalisierung des 19. Jahrhunderts sei von der heutigen durch eine Phase der „De-Globalisierung“ zwischen 1914 und ca. 1950 getrennt, wird widerlegt. Die als kritisch betrachtete „finanzmarktgetriebene“ Globalisierung wird lediglich als Spitze des Eisbergs gesehen, die durch die Liberalisierung der Finanzmärkte und die „vierte industrielle Revolution“ (Datenverarbeitung, Digitalisierung, Internet) hervorgebracht wurde.
Boris Loheide Knihy