Kirche in der Stadt
- 160 stránek
- 6 hodin čtení
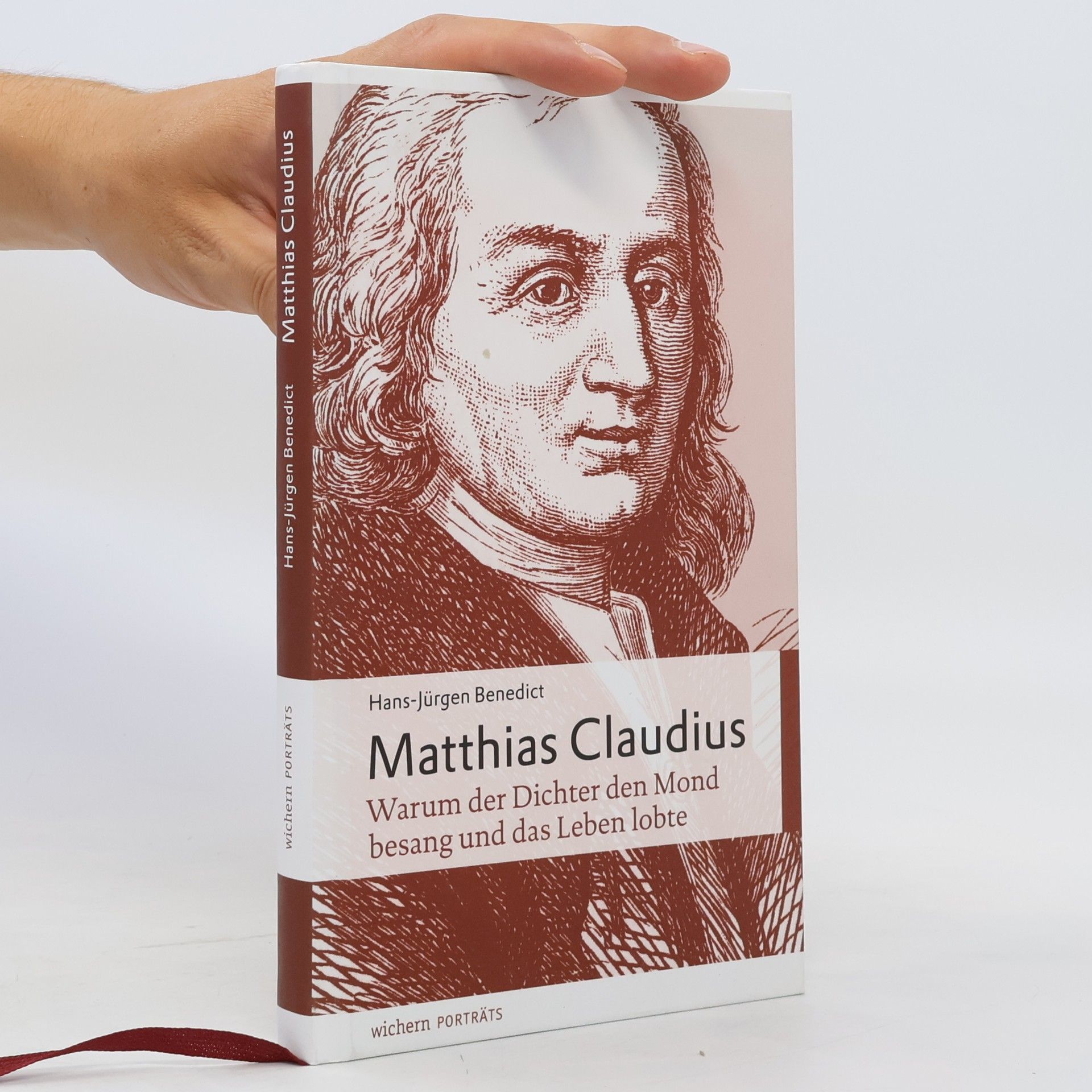


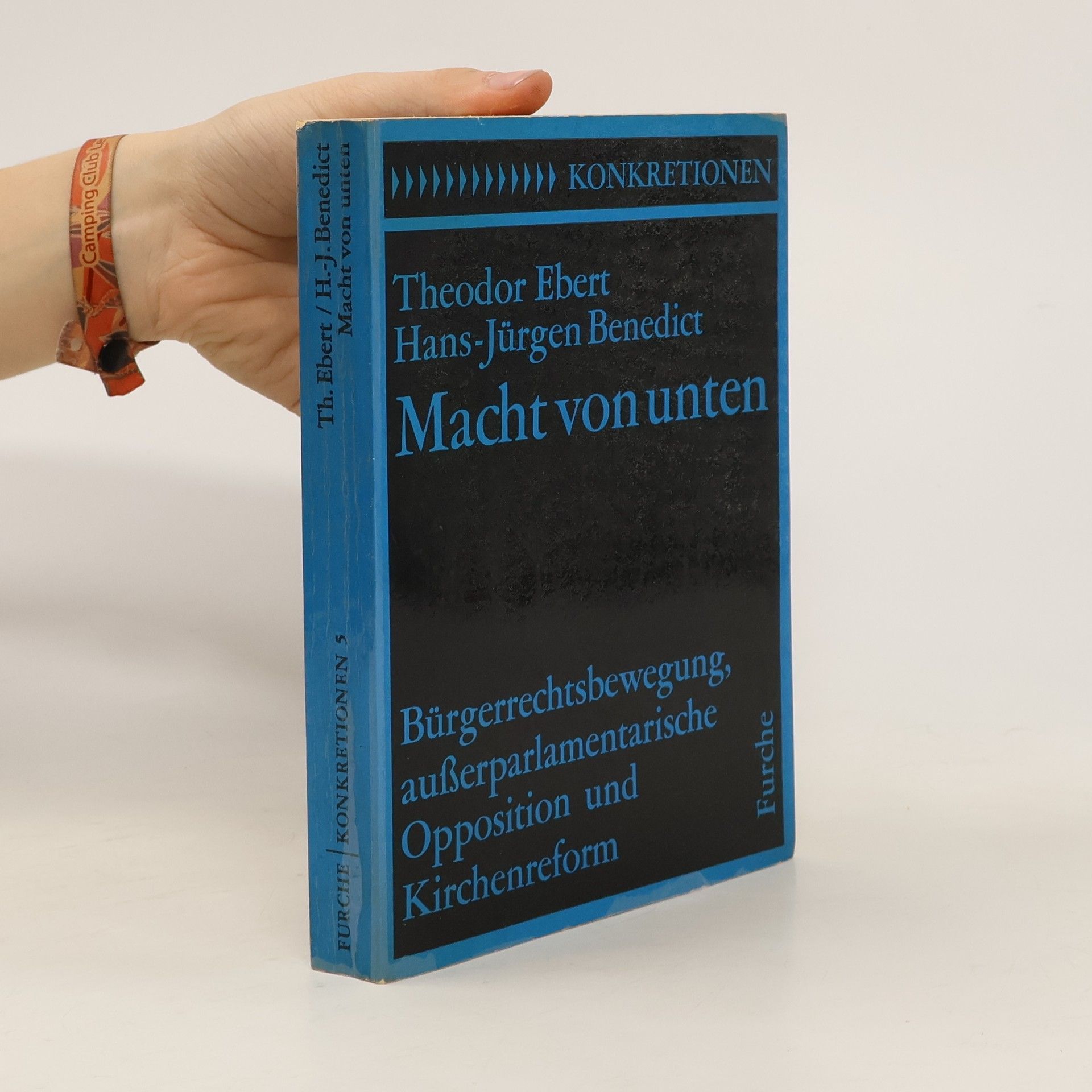
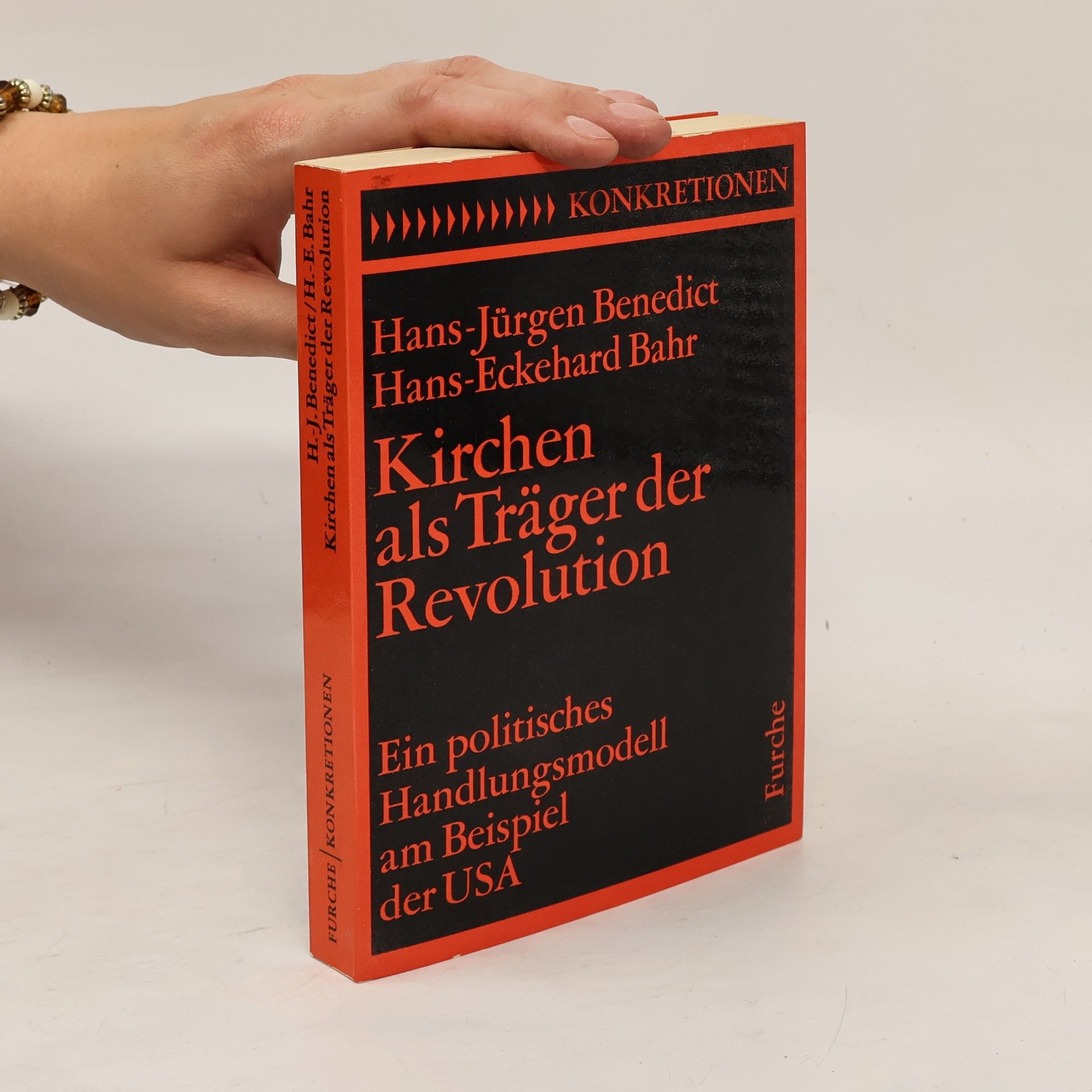
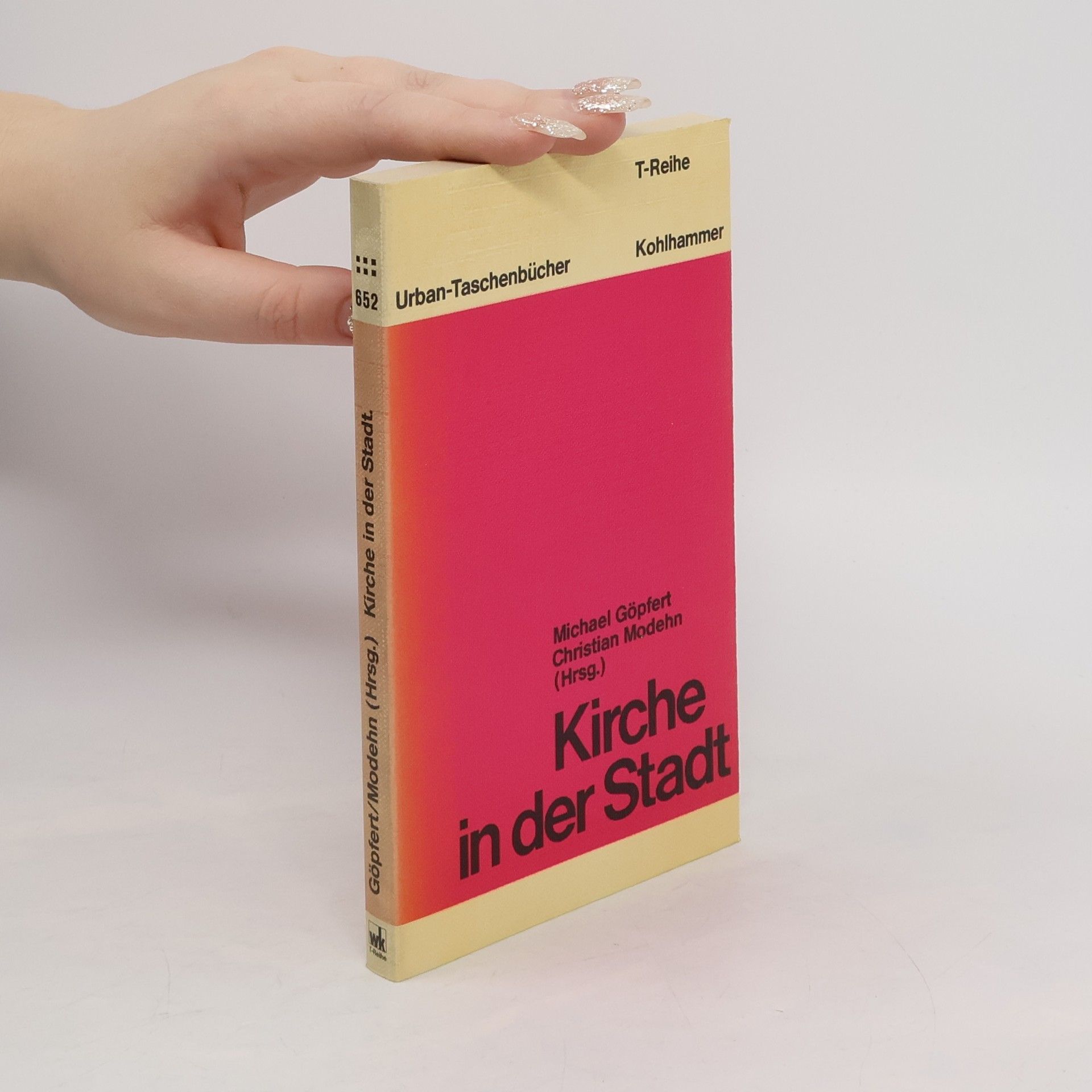
Mit der Corona-Pandemie haben sich Fragen des Sterbens und plötzlichen Todes aus dem Rahmen des Familiären in den Vordergrund der Öffentlichkeit gedrängt. Wie kann eine Gesellschaft der vielen Toten angemessen gedenken? Und gibt es Trost für die Hinterbliebenen?Hält man sich an die Literatur, so zeigt sich, dass die Sterberealität und ein im Jenseits liegender Trost nicht immer zur Deckung zu bringen sind. Am Ende wird mehr getröstet, als der kritische Verstand eigentlich erlaubt."Trost" versagt ohnehin vor der Shoah und wird doch in einzelnen Fällen (so in einer evangelischen Gemeinde im KZ Theresienstadt) zur Möglichkeit.
"Ich bin überzeugt, daß mit dem letzten Juden auch das Christentum aus Deutschland verschwindet." Diese Äußerung von Elisabeth Schmitz gegenüber Helmut Gollwitzer im November 1938 nimmt H.-J. Benedict zum Anlass, um noch einmal über das Versagen auch der Bekennenden Kirche angesichts der Judenverfolgung nachzudenken. Ist es nicht ein negatives heilsgeschichtliches Datum, das die Versöhnungswirkung des Todes Christi ernsthaft beschädigt hat? Zwar wurde die kirchlichen Strukturen staatskirchenrechtlich nach 1945 wiederhergestellt. Ist die gegenwärtige kirchliche Malaise, Mitgliederschwund und zunehmende Bedeutungslosigkeit, so fragt Benedict, nicht auch eine Folge dieses Versagens und nicht nur eine Konsequenz der Säkularisierung?
Nach dem Willen seines Vaters sollte Gotthold Ephraim Lessing (22. Januar 1729 – 15. Februar 1781) Pastor werden. Als Dichter und Dramatiker mischte er sich schließlich mehr und folgenreicher in Theologie und Kirche ein, als es ihm von der Kanzel aus möglich gewesen wäre. Vom Geist der Aufklärung erfasst, widmete er sich als Literat unermüdlich der Wahrheitssuche. Mit Hilfe des Theaters wollte er Seelen bewegen. Die Religionen beurteilte er nach ihrer Moral. Am deutlichsten tritt sein Ansinnen in dem Drama „Nathan der Weise“ zu Tage, das die Religionen eindringlich – und bis heute erstaunlich aktuell – zu Toleranz auffordert. Deshalb ist Heinrich Heines Lob nachvollziehbar: Seit Luther hat Deutschland keinen größeren und besseren Mann hervorgebracht als Gotthold Ephraim Lessing. Hans Jürgen Benedicts Porträt zeigt nicht nur den geachteten Dichter und Dramatiker, sondern auch den Rastlosen und verschuldeten Spieler, der einige Schicksalsschläge erleiden musste. Wie viel leichter andächtig schwärmen als gut handeln ist!