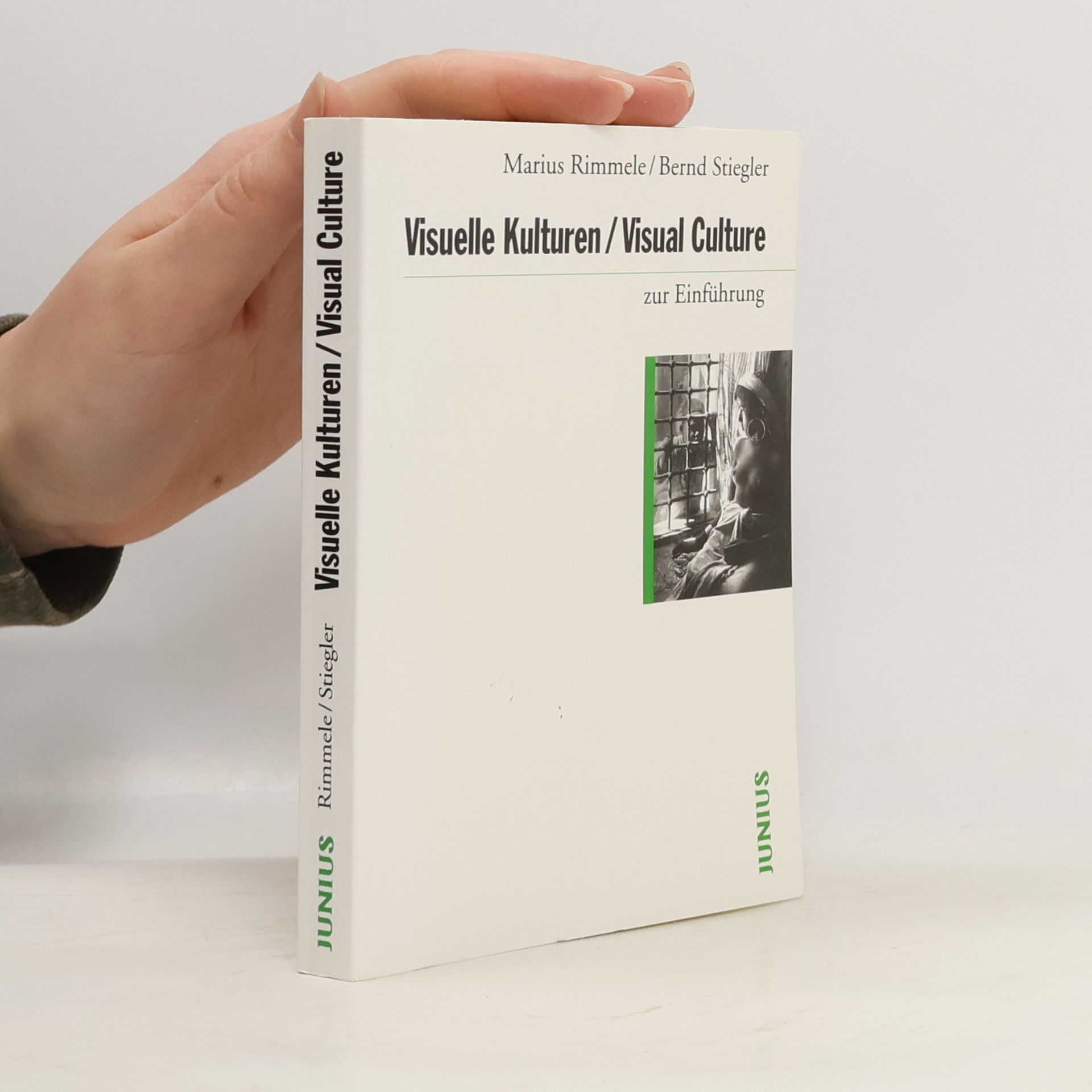Das Triptychon als Metapher, Körper und Ort
Semantisierungen eines Bildträgers
- 361 stránek
- 13 hodin čtení
Tradition des Schreins stehen. Auch weil sie mechanisch Bilder bewegen und eine symbolträchtige Schichtung von Außen- und Innenseite aufweisen, provozieren sie die Auseinandersetzung mit der ihnen eigenen Körper- und Örtlichkeit. Die medialen Eigenheiten werden im Moment ihrer Einbindung in die Bildaussage zu Kristallisationspunkten religiös geprägter Bildtheorien – offizieller wie unausgesprochener. Auf der Suche nach Reflexionen über die Medialität des Bildträgers interpretiert Marius Rimmele ausgewählte Triptychen und insbesondere die Vorgänge des Öffnens und Verschließens vor dem Hintergrund religiöser Praktiken und Theorien sowie theologischer Sprachbilder. Die gesammelten Beispiele einer deutlichen Semantisierung des Bildträgers als sinnbildliche Struktur, als heiliger Ort und als Spiegel der Bilder im Körper offenbaren damaliges Bilder-Wissen ebenso wie ein auf die materiellen Bilder gerichtetes Begehren.