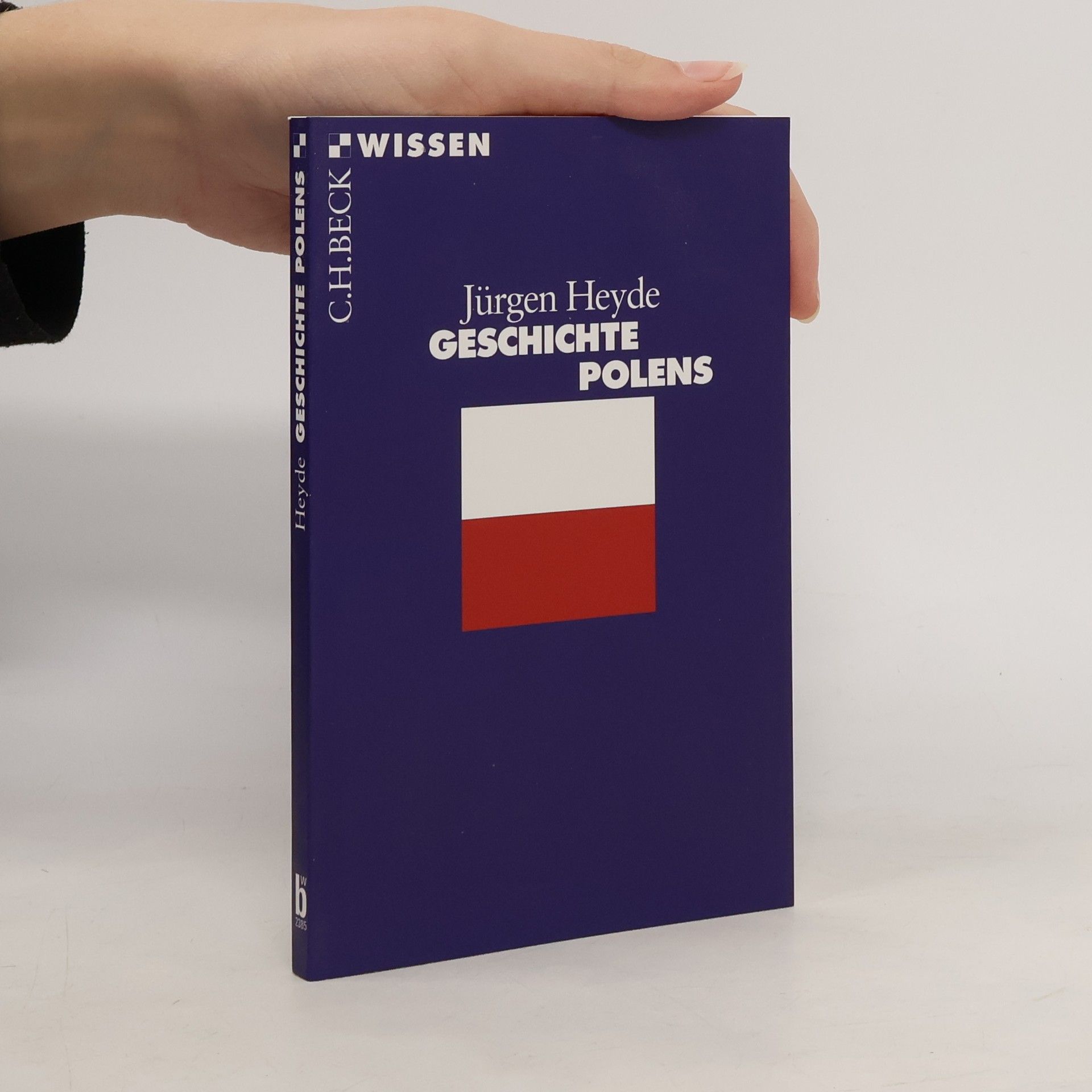In seinem inzwischen zum Klassiker gewordenen Band gibt Jürgen Heyde einen Überblick über die mehr als tausendjährige Geschichte Polens. Neben der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes liegt das besondere Augenmerk auf der Darstellung der europäischen Dimensionen der polnischen Geschichte sowie der Entwicklung der deutschpolnischen Nachbarschaft. Für die Neuauflage wurde der Band gründlich durchgesehen und bis zur Gegenwart fortgeführt.
Jürgen Heyde Knihy
1. leden 1965