Mémoire de̓lles
- 142 stránek
- 5 hodin čtení
Analyse : Roman psychologique (intime). Roman familial.

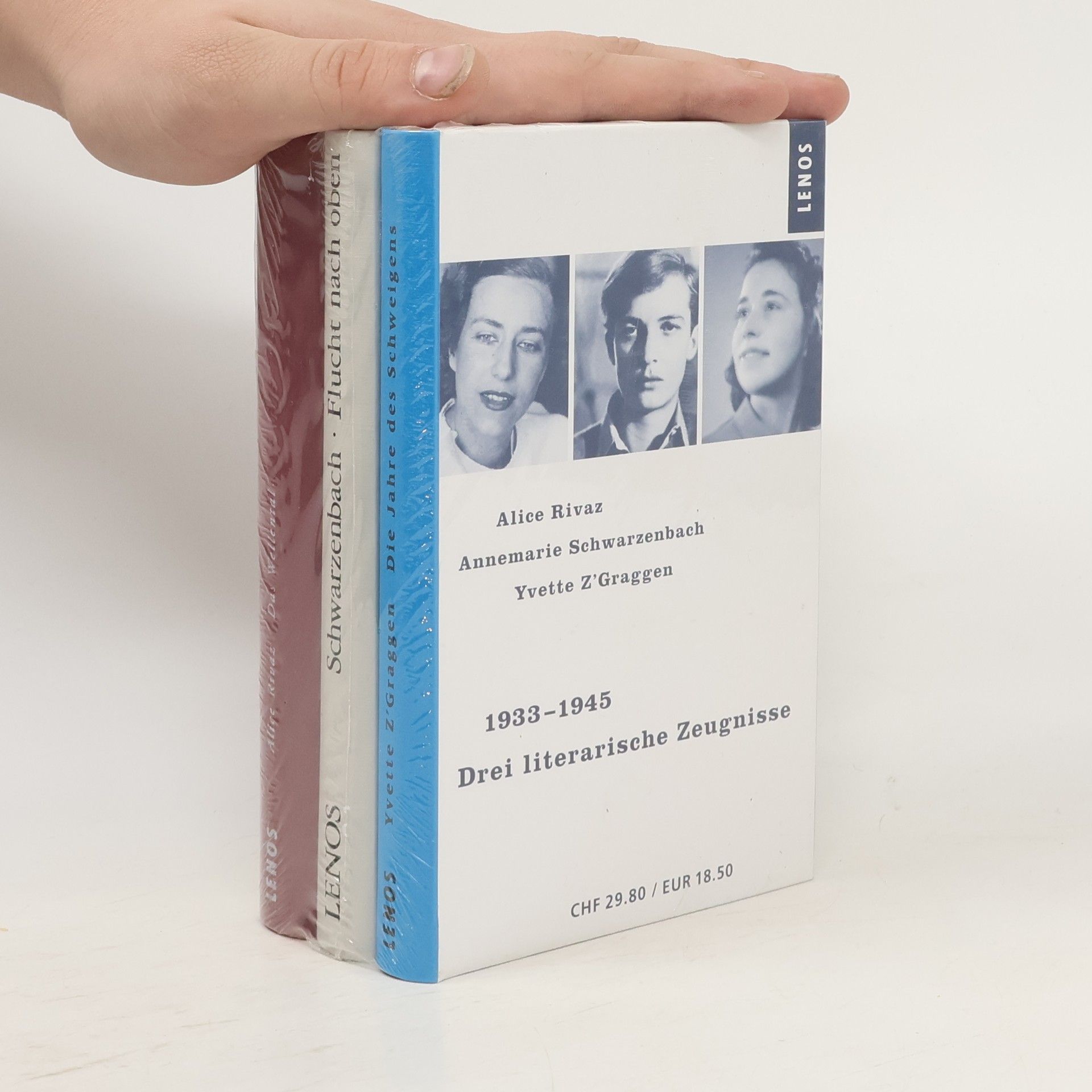
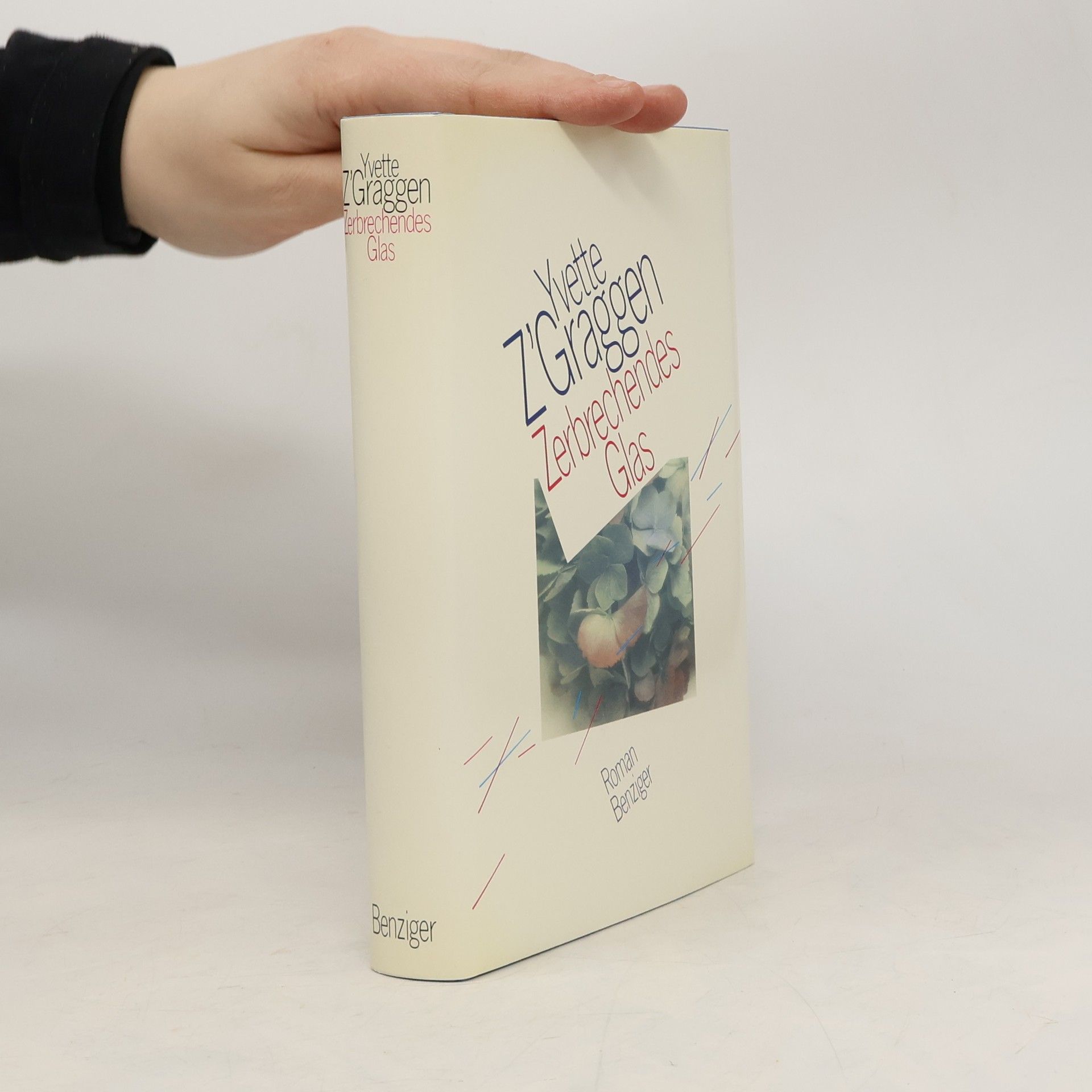
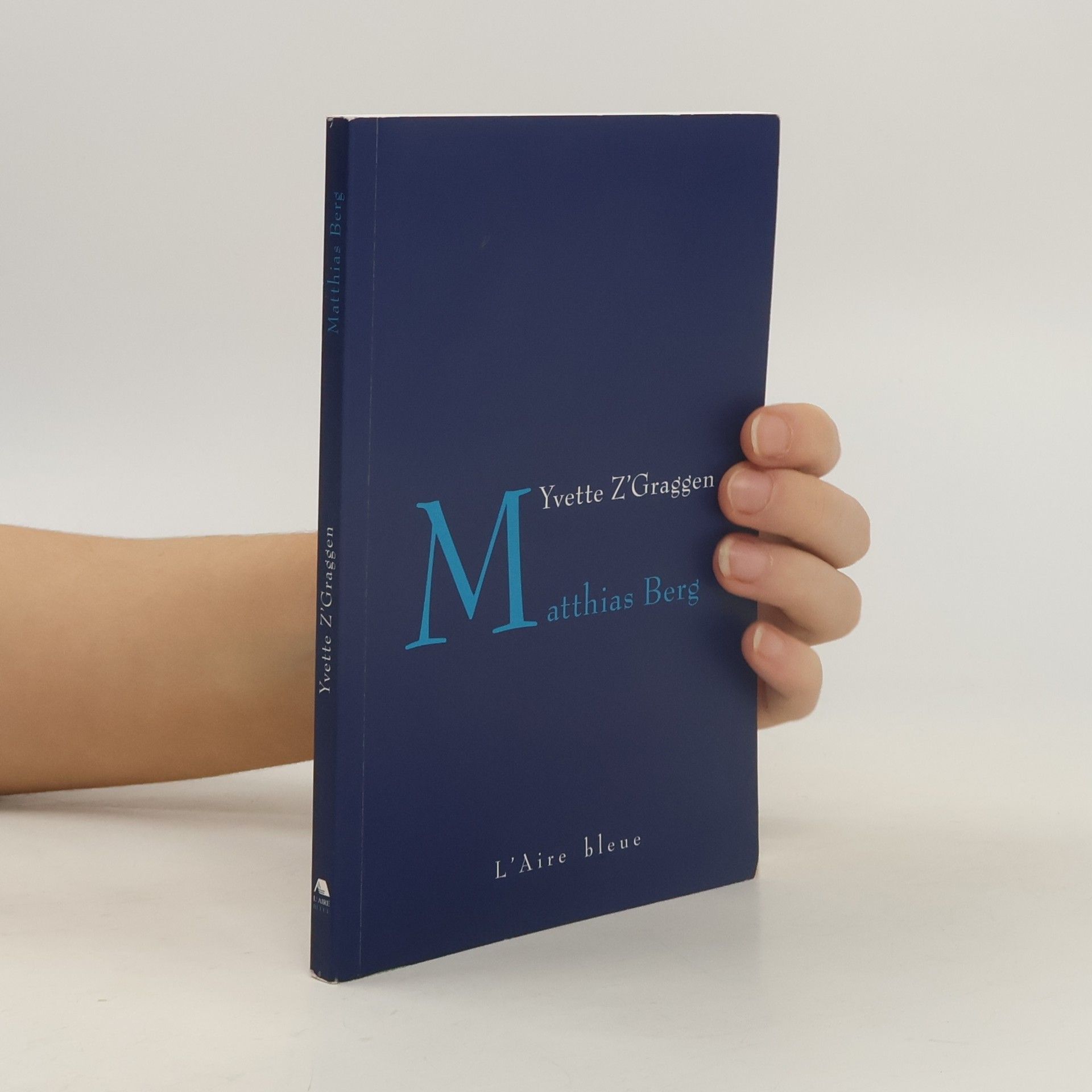

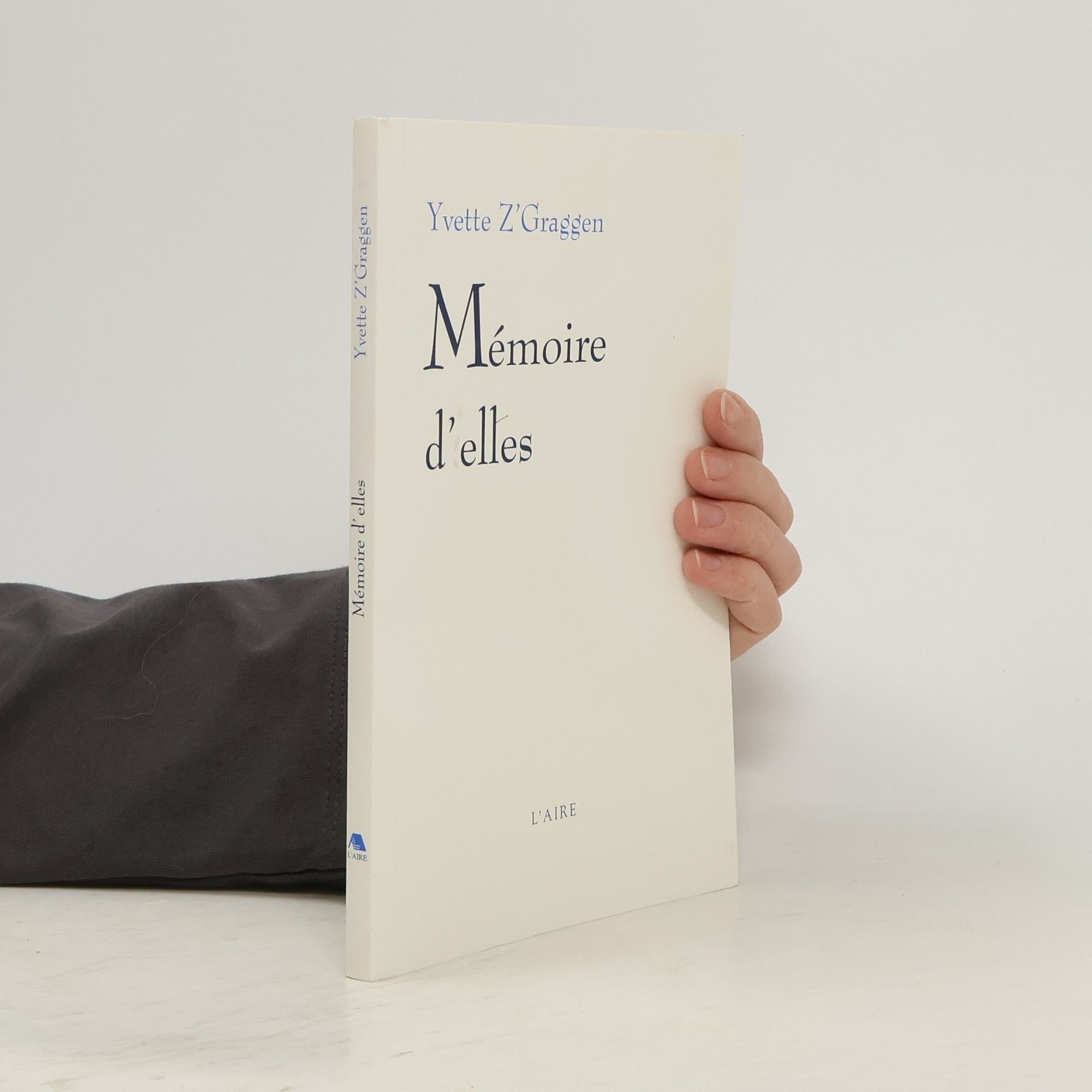
Analyse : Roman psychologique (intime). Roman familial.
"Ich bin kein Verbrecher!", schrieb der junge Deutsche Herbert 1946 an Yvette Z’Graggen. Sie hatte ihn kurz vor Kriegsausbruch in Genf kennengelernt, eine enge Brieffreundschaft verband sie seither. Doch nach 1950 wendet sie sich ab von Deutschland. Erst drei Jahrzehnte später wagt sie eine behutsame Wiederentdeckung, den Versuch einer Versöhnung: Mit dem Besuch der Gedenkstätten des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in Berlin verändert sich allmählich Yvette Z’Graggens Bild von den Deutschen. Unerbittlich setzt sie sich mit der Vergangenheit und auch den Rissen in ihrer eigenen Lebensgeschichte auseinander.
Juin 1994. Au centre de Berlin, près du Kurfürstendamm et de l'église du Souvenir, un square tranquille, presque provincial. Assise sur un des bancs, Marie, vingt-quatre ans, observe un vieil homme qui jette du pain aux moineaux. Elle est venue de Genève, où elle est née, pour le retrouver, le rencontrer pour la première fois. Maintenant qu'elle touche au but, elle hésite, manque de courage. Tandis que le face-à-face se prolonge, des voix se croisent dans la tête de Marie : elles lui racontent une histoire dramatique qu'elle n'a pas vécue, celle de sa grand-mère allemande, Beate, celle d'Eva, sa mère, devenue Suisse par son mariage, mais qui n'a jamais pu se libérer du passé. Ces voix lui parlent aussi de son grand-père, ce rescapé de la campagne de Russie qu'Eva a rejeté avec violence : Matthias Berg, le vieil homme aux moineaux
Eine kurze Liebesbeziehung verändert das Leben einer alleinstehenden Frau über 50.
September 2009: Inspiriert vom medialen Gedenken an den siebzigsten Jahrestag des Kriegsbeginns, fragt sich Yvette Z'Graggen, wie ihr Leben verlaufen wäre, hätte Yvie, ihr Alter Ego, damals im Sommer 1938 den jungen Deutschen nicht abgewiesen. Aus der Erinnerung an eine kurze Romanze, die sie mit achtzehn erlebte, entwickelt die Autorin eine Geschichte, deren Protagonistin zweifellos die stärkste und freieste ihrer Figuren ist, da sie sich der bürgerlichen Moral ihres Umfelds widersetzt. In einem zweiten Teil verabschiedet sich Yvette Z'Graggen von den Heldinnen ihrer Bü "Sie widerspiegeln jede auf ihre Art die Entwicklung der Frauen über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg. Sie haben versucht, die Unwissenheit, die Verlogenheit, die Vorurteile zu bekämpfen, die in ihrer Kindheit noch herrschten. Sie haben auch begriffen, dass die innere Freiheit wesentlich ist, und sie haben sich gegen alles zur Wehr gesetzt, was sie gefangen hielt." Für dieses Buch wurde Yvette Z'Graggen 2012 postum der Prix Edouard Rod verliehen.
Fünfundzwanzig Perlen auf der Kette eines Lebens, fünfundzwanzig kleine Berichte am Faden der Zeit, die Licht auf die ferne und nahe Vergangenheit werfen und durch das Werk von Yvette Z'Graggen hallen. Obwohl es als letztes Buch bezeichnet wird, hat es nichts Testamentarisches an sich, sondern verweist auf andere und die Zukunft. Jeder „Splitter“ ist eine kleine Geschichte, die es dem Leser ermöglicht, der Erzählerin von der Kindheit bis ins hohe Alter zu folgen, begleitet von Z'Graggens charakteristischem Einfühlungsvermögen. Dieser Streifzug durch ein Leben ist eine Synthese der großen Themen ihres Werks: Trennung, Unverständnis, Einsamkeit, aber auch Teilnahme, Einssein und Gemeinsamkeit. Es gibt glückliche, aber auch viele schmerzliche Erinnerungen, wobei insbesondere die letzten Zeugnisse von den Mühen des Alters tief berühren. Diese Geschichten sollten am Stück gelesen werden, da sie das Porträt einer edelmütigen, herzlichen Frau zeichnen, die ohne Bitterkeit in Schattenzonen zu leuchten versucht. Die Rückschau öffnet sich dankbar den anderen, deren Hilfe unentbehrlich geworden ist. Die Hand des kleinen Mädchens hält sich am Arm des Enkels, dessen Leben die Geschichte weitertragen wird. Es sind keine Sensationen, die festgehalten werden, sondern persönlich erlebte Verletzungen und Beglückungen, die mit Sensibilität und Ausdruckskraft festgehalten werden und den Leser zur vollen Aufmerksamkeit einladen.