Rudolf Schröder Knihy
1. leden 1943
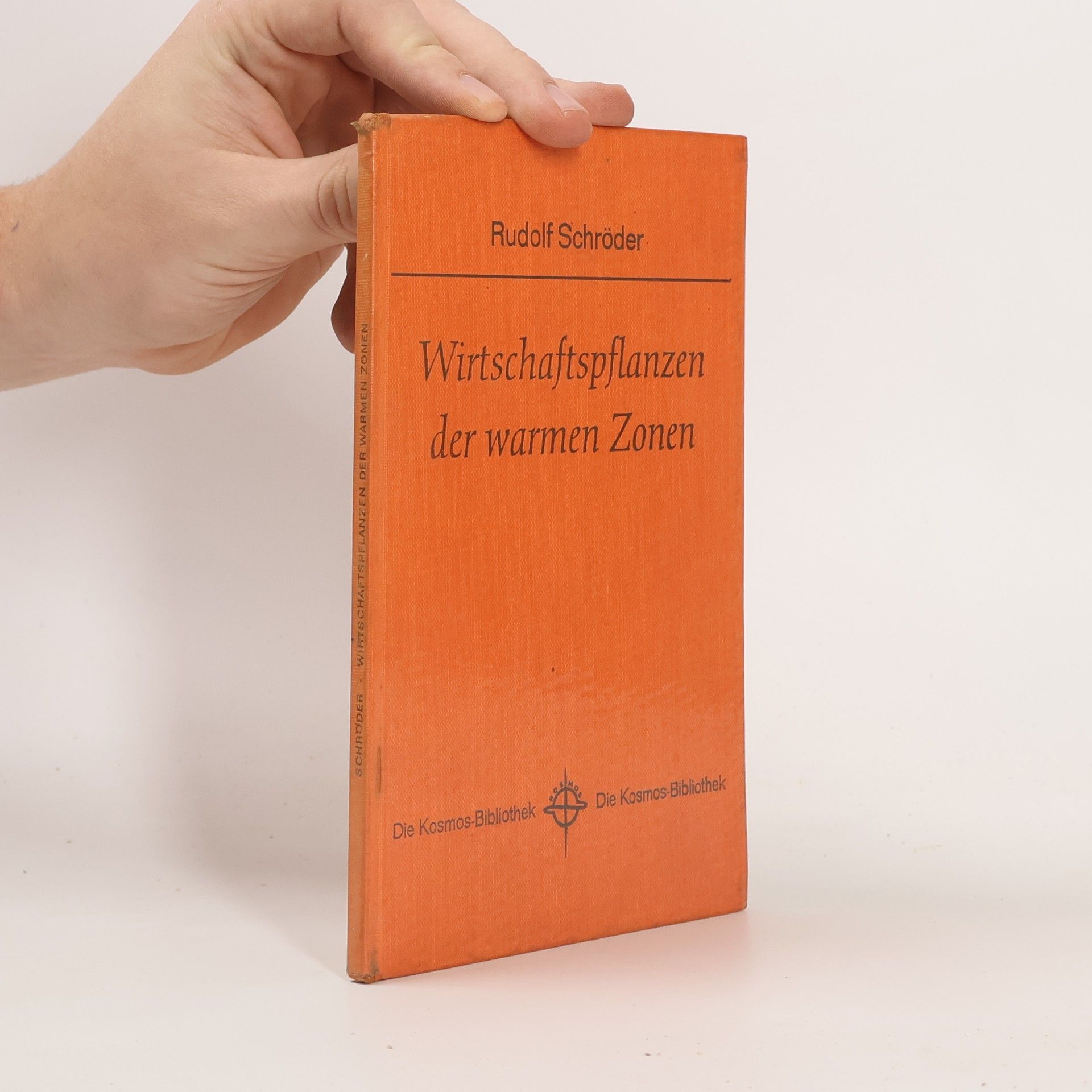
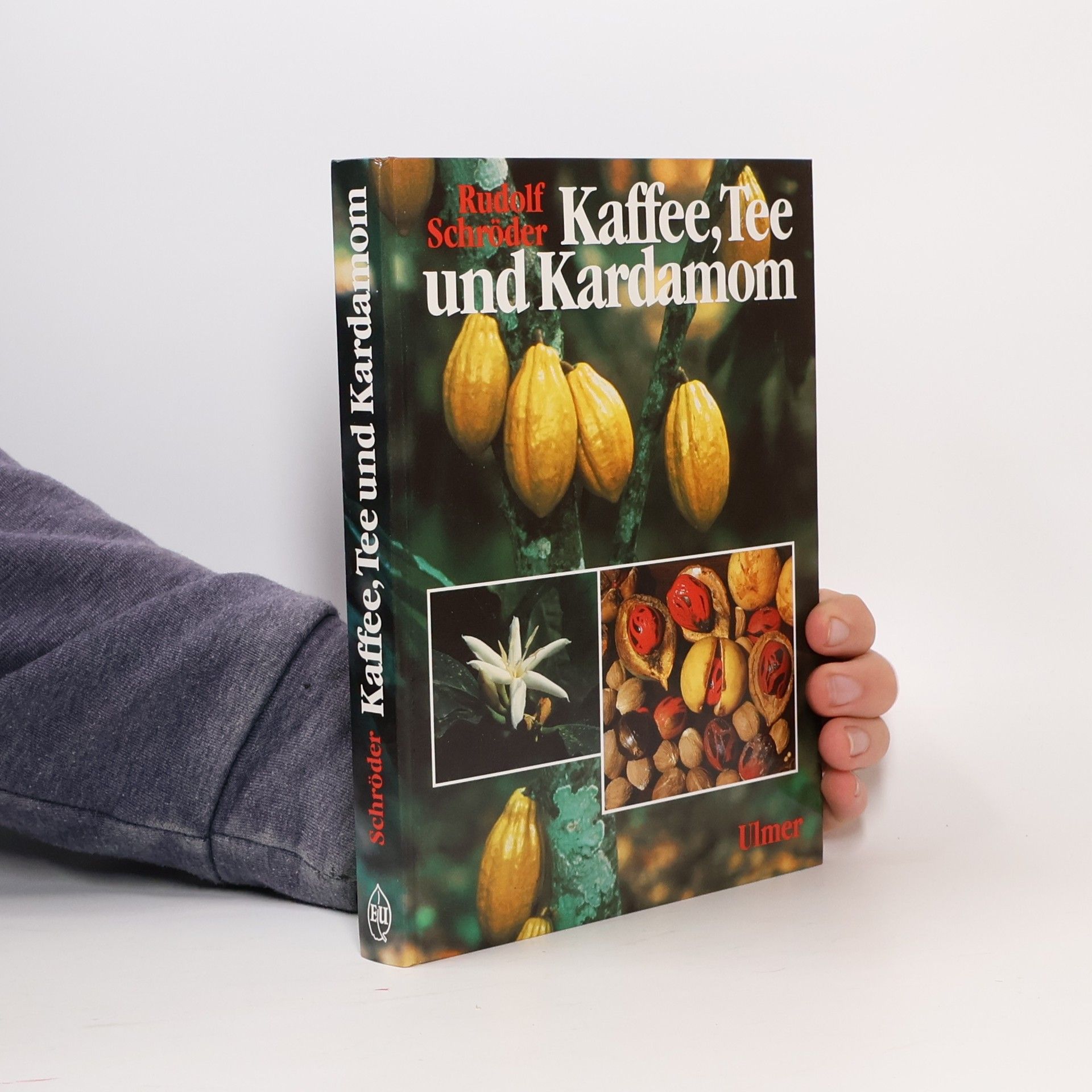


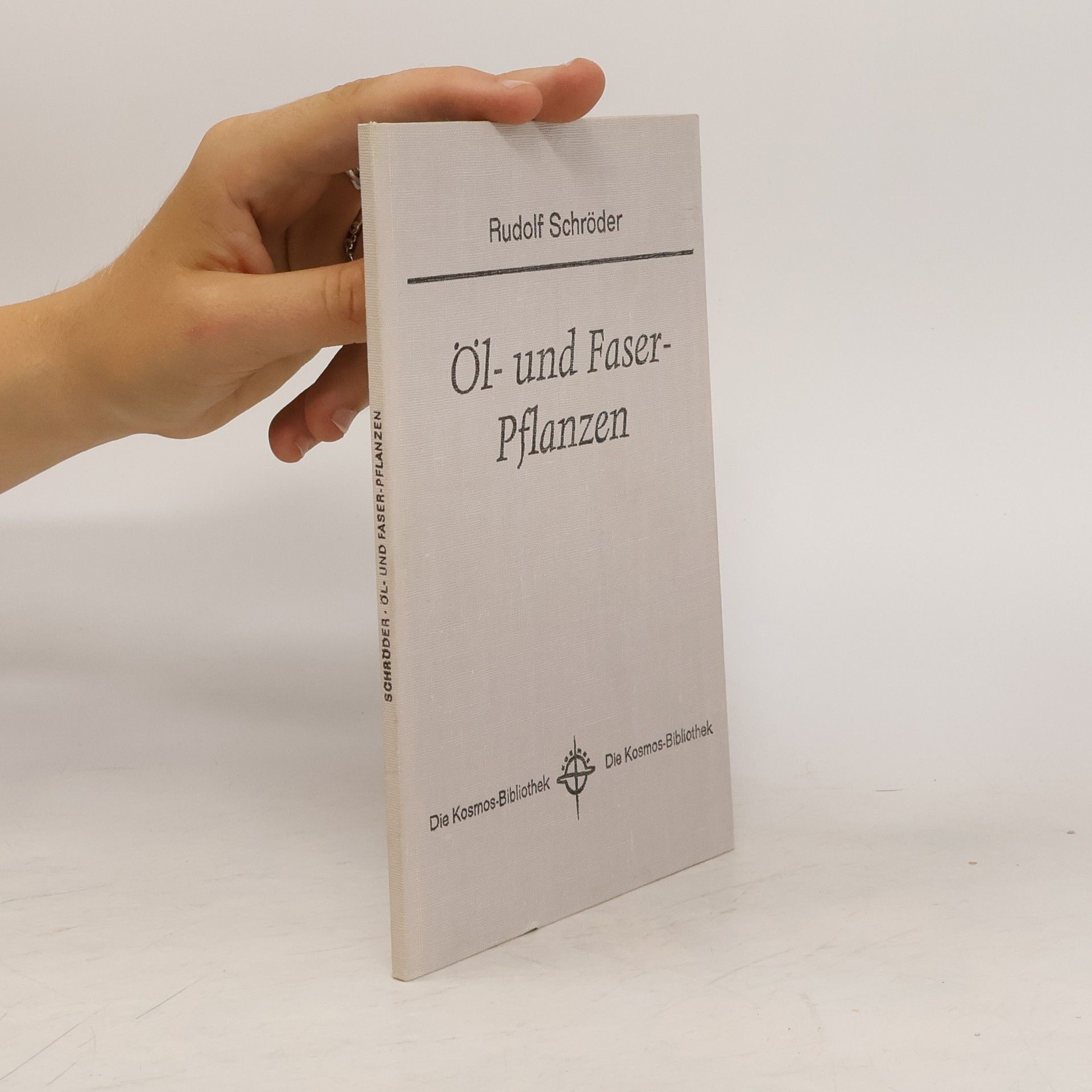
Wieviel ist ein Unternehmen wert? Wie ermittle ich den „good will“? Was ist mit der Lebensversicherung? – Bewertungsfragen im Zugewinn sind von entscheidender Bedeutung: Es geht ums Geld – Ungenauigkeiten kommen den Beteiligten teuer zu stehen! Ein zuverlässiger Begleiter in diesem mit komplizierten Fragestellungen gespickten Gebiet ist daher unerlässlich!
Kaffee, Tee und Kardamom
tropische Genussmittel und Gewürze : Geschichte, Verbreitung, Anbau, Ernte, Aufbereitung
- 264 stránek
- 10 hodin čtení