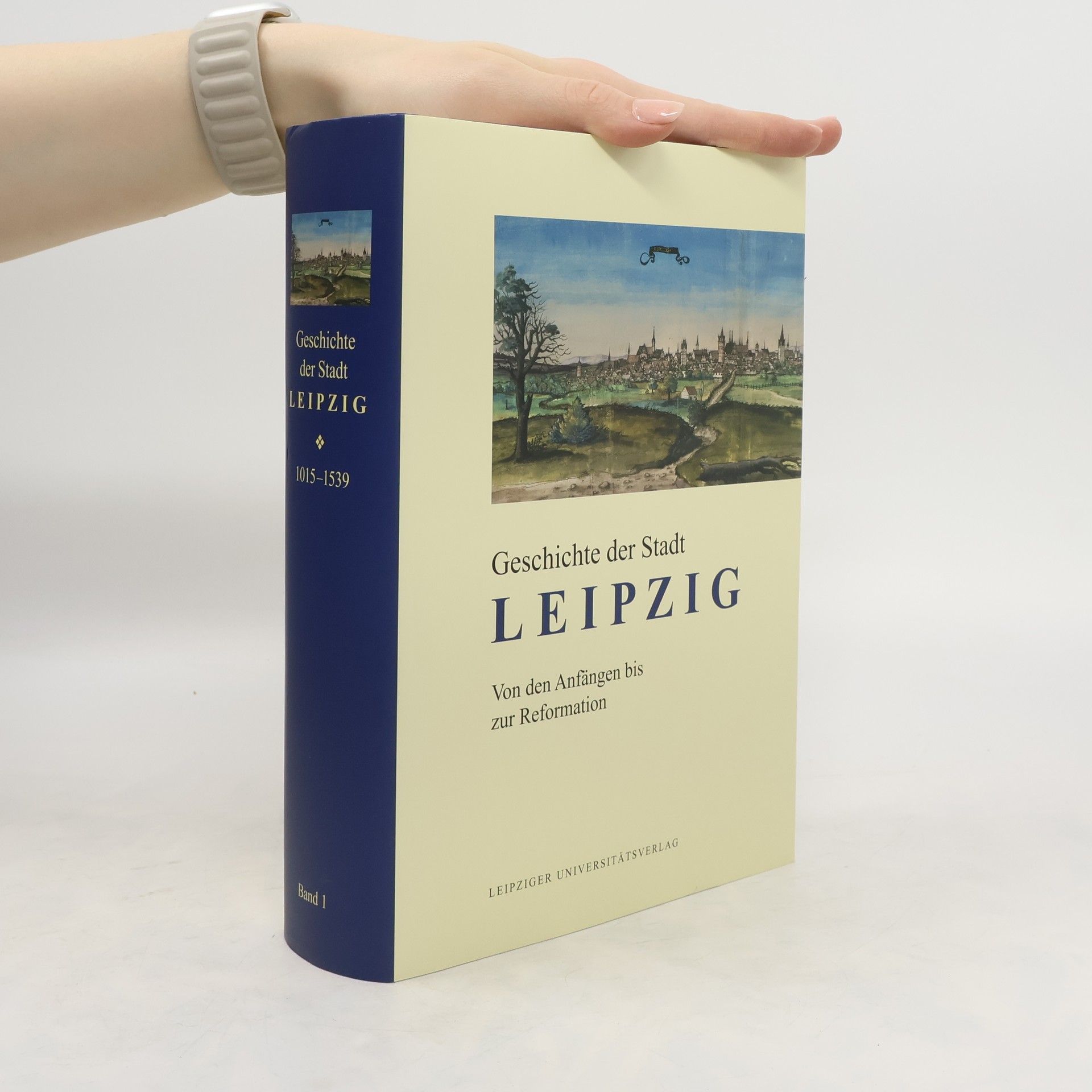Der Leibarzt als neues Phänomen an den Fürstenhöfen des späten Mittelalters
- 38 stránek
- 2 hodiny čtení
Die Professionalisierung des Arztestandes beginnt im Mittelalter. Der gelehrte Leibarzt, der "physicus", der sich bereits im 12. Jahrhundert an europaischen Konigshofen nachweisen lasst, wird im spaten Mittelalter zu einem neuen Phanomen an den Furstenhofen im Heiligen Romischen Reich. Dort vollzieht sich sowohl ein Akademisierungs- als auch ein Professionalisierungsprozess, an dem Heilkundige aller Art partizipieren. Leibarzte gehorten im spaten Mittelalter zum reprasentativen und gut bezahlten Personal eines Furstenhofes von Rang. Neben ihrer Dienstbindung an den Fursten wurden sie vielfach als Stadtarzte und als Universitatsgelehrte tatig. Kurzum: Der Leibarzt ist zwar ein neues Phanomen an den Hofen des spaten Mittelalters, aber seine Bedeutung kann allein aus der Perspektive des Hofes nicht angemessen gewurdigt werden. Vielmehr soll deutlich werden, dass sich die Tatigkeit der Leibarzte im Dreieck von Hof, Stadt und Universitat entfaltet hat. Als Fallbeispiele dienen die Hofe der Landgrafen von Hessen und der Grafen von Wurttemberg. Die Untersuchung zeigt, dass die Leibarzte ein bisher zu wenig beachteter Aspekt mittelalterlicher Lebenswelten sind.