Den in Seminaren und Vorlesungen gestellten Anforderungen entsprechend hat Christa Dürscheid das grundlegende Syntax-Wissen zusammengetragen und präsentiert es nun, didaktisch aufgearbeitet, in einem Studien- und Arbeitsbuch, das sich sowohl zur Einarbeitung im Grundstudium als auch zur Wiederholung sowie Vertiefung im Hauptstudium eignet. Im ersten Teil vermittelt die Autorin das nötige Handwerkszeug zur Analyse syntaktischer Strukturen im Allgemeinen sowie der deutschen Sprache im Besonderen. Die hierdurch erworbenen Kenntnisse und das Grundvokabular sind Voraussetzungen für das Verständnis der im zweiten Teil behandelten Forschungsansätze: Das Stellungsfeldermodell, die Valenztheorie, die Generative Grammatik und die Funktionale Grammatik werden vorgestellt und auf ihren Nutzen hin überprüft. Anhand von Wiederholungs- bzw. Übungsfragen kann das Erlernte erprobt und gefestigt werden. Hilfreich hierfür sind außerdem die beigefügte Lösungsvorschläge und das Glossar.
Christa Dürscheid Knihy

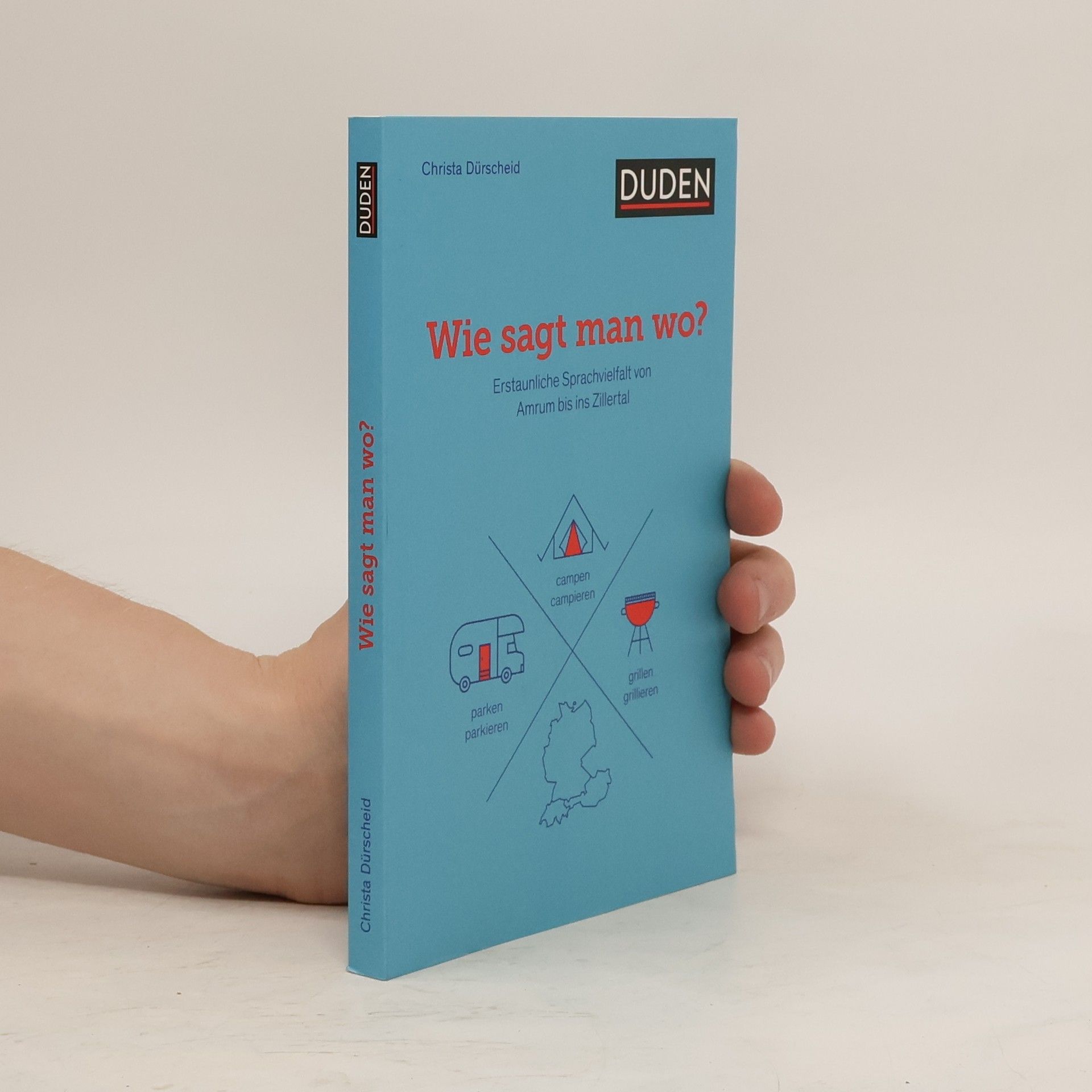

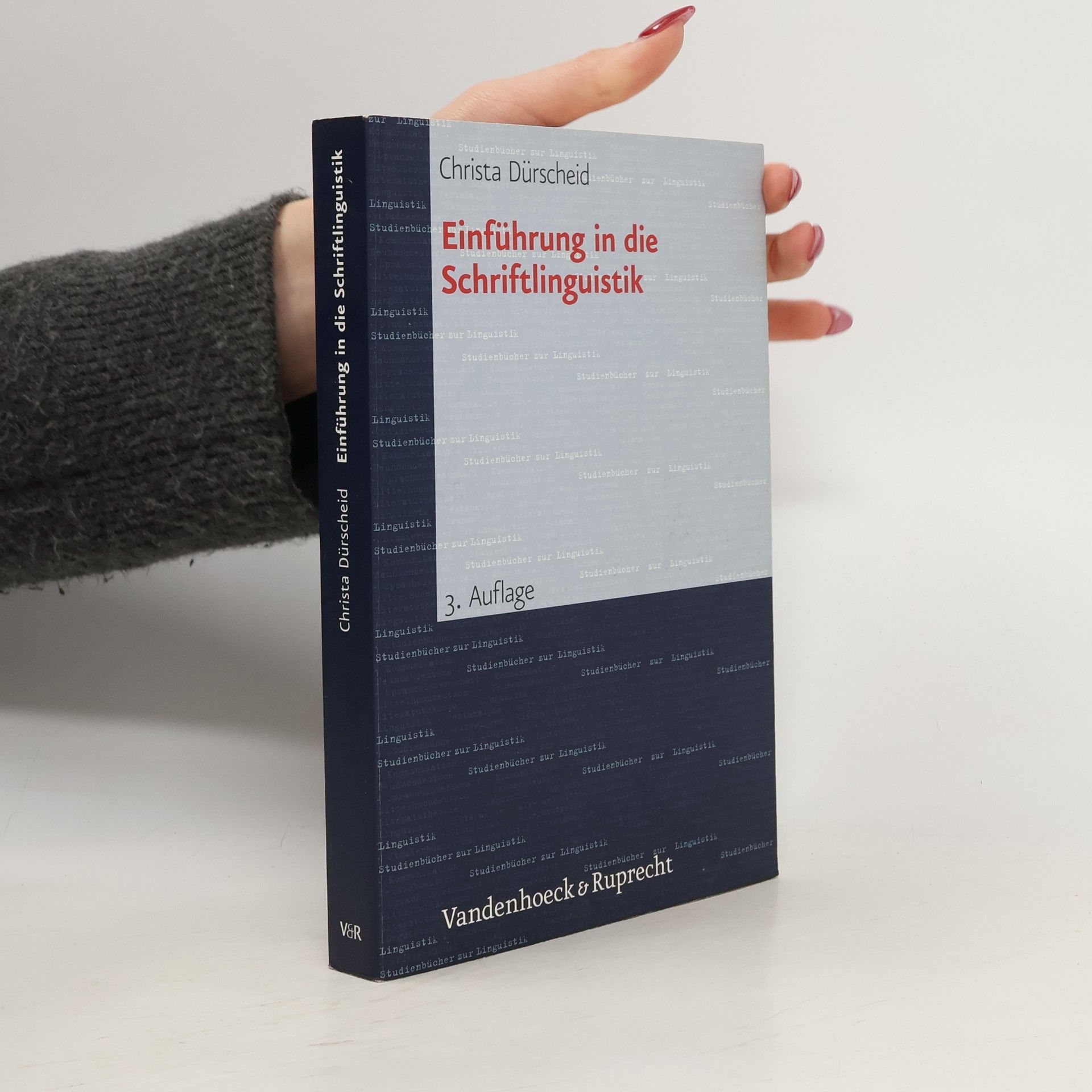

Einführung in die Schriftlinguistik
- 319 stránek
- 12 hodin čtení
Dem Buch liegt die Annahme zugrunde, dass die Schrift keineswegs, wie vielfach behauptet, ein sekundäres, der Sprache nachgeordnetes System ist, sondern eine eigenwertige, voll funktionale Realisierungsform von Sprache. Geboten wird ein instruktiver Überblick über die linguistisch relevanten Aspekte von Schrift (Unterscheidung von gesprochener und geschriebener Sprache, Charakteristika von Schrifttypen und Schriftsystemen, Schriftgeschichte, Graphematik, Orthographie, Schriftspracherwerb). Hergestellt werden auch aktuelle Bezüge (so zum Schreiben im Internet, zur Rechtschreibreform, zu neuen Verschriftungstendenzen). Der Leser erhält auf diese Weise eine kompakte Einführung in eine Thematik, die in den letzten Jahren zunehmend studien- und examensrelevant wurde. Übungsaufgaben, Lösungsvorschläge, kommentierte Literaturhinweise und ein ausführliches Glossar runden das Buch ab.
Der Band von Christa Dürscheid bietet tiefgehende Einblicke in die Herausforderungen der grammatischen Zweifelsfälle im Deutschunterricht und untersucht das Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit, insbesondere in digitalen Kommunikationsformen. Durch die Analyse von Sprachdidaktik, Medienlinguistik und Grammatikforschung werden innovative Perspektiven für den Deutsch- und DaF-Unterricht aufgezeigt. Zudem werden spezifische grammatische Phänomene behandelt, die die Faszination der deutschen Grammatik unterstreichen und deren Relevanz in der heutigen Kommunikation verdeutlichen.
Wie sagt man wo?
Erstaunliche Sprachvielfalt von Amrum bis ins Zillertal
Viele wissen, dass man in Berlin eine 'Schrippe', in München eine 'Semmel' und in Bern ein 'Weggli' kauft. Dass man in der Schweiz 'parkiert' und nicht 'parkt', wenn man sein Auto auf einem Parkplatz abstellt, ist vielleicht schon weniger bekannt. Und wann genau man das Wörtchen 'halt' verwendet, ob man es nur sagen oder auch schreiben kann und was es eigentlich bedeutet, ist für die meisten wohl eine Frage des Sprachgefühls. Die Autorin sammelt solche sprachlichen Besonderheiten und Entwicklungen und erklärt kurz und bündig, was dahintersteckt