Deutschland im Umbruch
Essays zur Gegenwart

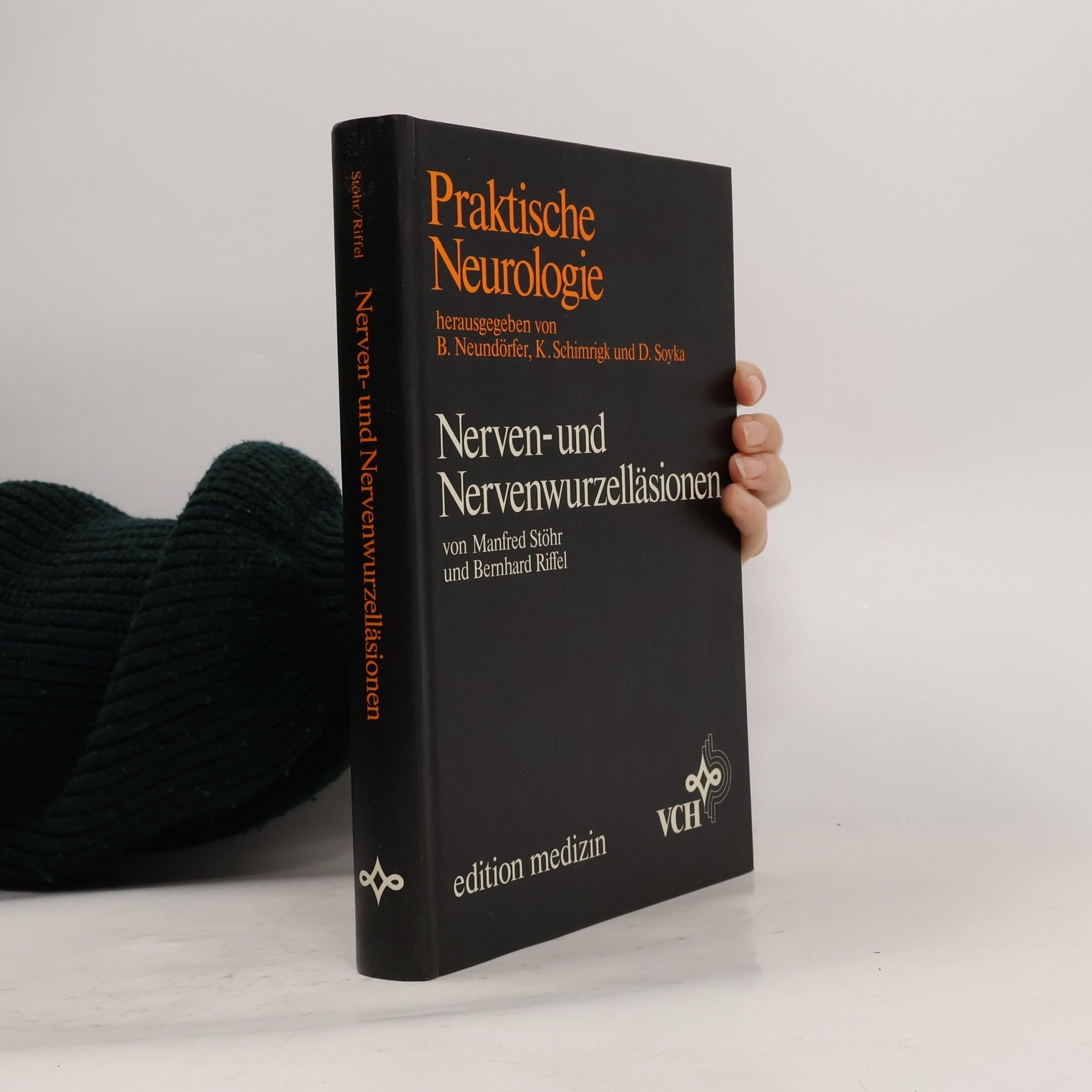



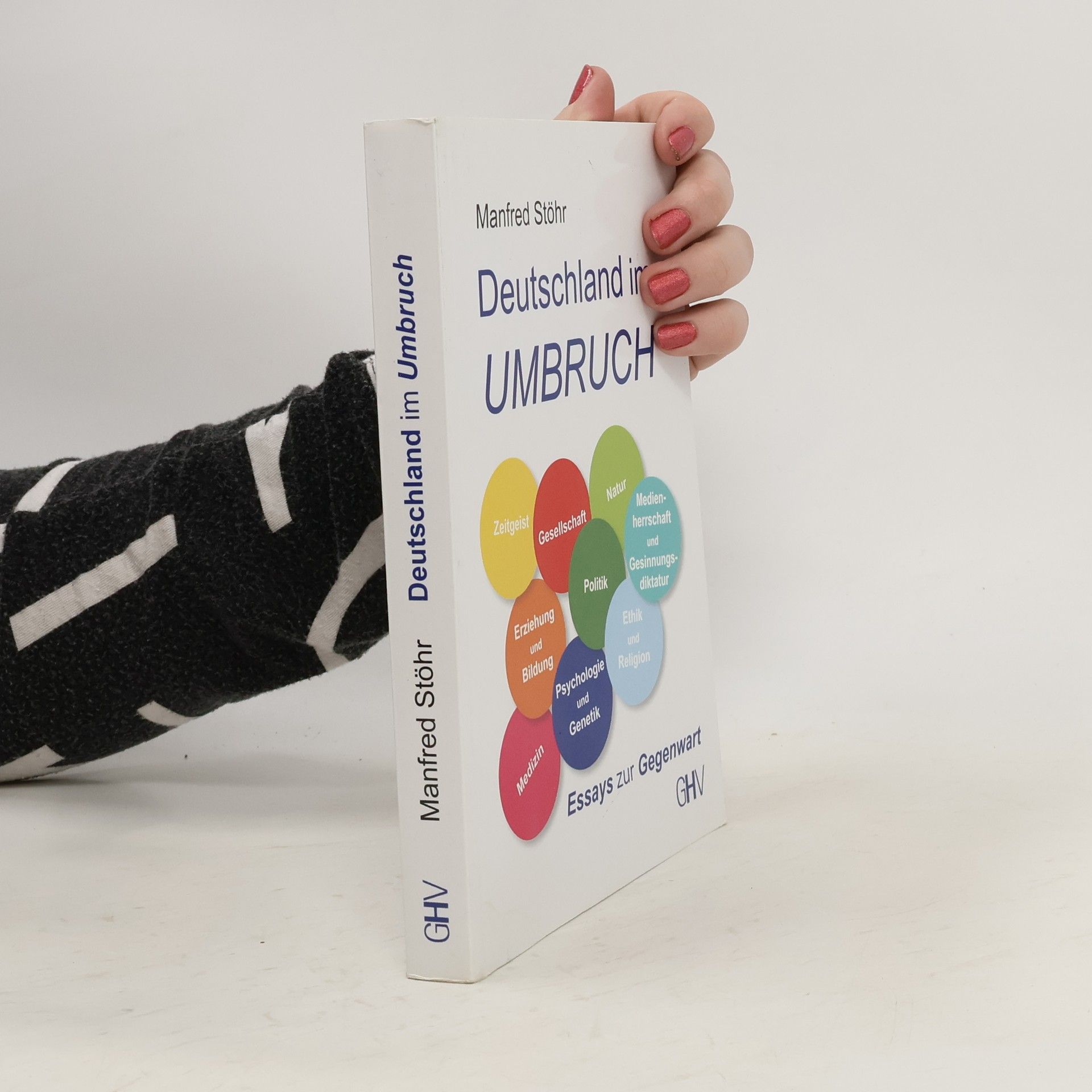
Essays zur Gegenwart
Lehrbuch und Atlas
Dieses Werk stellt seit uber 30 Jahren das deutschsprachige Standardwerk der Klinischen Elektromyographie dar, das alle relevanten Einsatzbereiche abdeckt. Fur die 6. Auflage liegt es in uberarbeiteter und erweiterter Fassung vor. Es zeichnet sich aus durch die hochsten Anforderungen gerecht werdende Druck- und Abbildungsqualitat und durch die ebenso umfassende wie pragnante Darstellung aller klinisch relevanten Indikationen. Dabei wird nicht nur die gesamte Palette an neuro-muskularen Erkrankungen abgedeckt (Nerven- und Plexuslasionen, Polyneuropathien, Motoneuronerkrankungen, Myopathien), sondern auch wichtige Einsatzmoglichkeiten bei zentralnervosen Syndromen (Tremor, Dystonien, Blepharospasmus, Hirnstammlasionen, Stiff-man-Syndrom usw.) sowie die neurophysiologische Funktionsdiagnostik des autonomen Nervensystems und der ano-genitalen Syndrome besprochen. Mit 335 Abbildungen und 29 Tabellen lasst sich das Werk als fundiertes Lehrbuch und anschaulicher Atlas in der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie im klinischen Alltag einsetzen.
Schulmedizin und alternative Heilverfahren auf dem Prüfstand
Das heutige Gesundheitswesen gleicht einem Supermarkt mit einer kaum noch überschaubaren Vielfalt an medizinischen Angeboten. Die Schulmedizin mit ihrer Überbewertung des Apparativen, bei gleichzeitiger Vernachlässigung psychosozialer Faktoren, befindet sich trotz aller Erfolge in einer Vertrauenskrise, die mitverantwortlich ist für das Eindringen verschiedenster exotischer Gesundheitssysteme und das Wiederaufblühen vergessen geglaubter traditioneller Heilweisen. Das Spektrum dieser alternativen Medizin reicht von vernünftigen naturheilkundlichen Ansätzen über ungesicherte, aber ernsthaft zu prüfende fernöstliche Heilmethoden bis hin zu skrupellosen Scharlatanen, die kranke Menschen gnadenlos abzocken. In dieser Situation bedarf es einer kritischen Analyse, die dieses Buch leistet: Ihr Ziel ist die Integration von einzelnen akzeptablen alternativen Heilweisen, wie sie besonders bei leichten oder chronischen Erkrankungen sinnvoll einsetzbar sind, in eine reformierte Schulmedizin.