Kalkül der Scham
Der soziale Affekt und das Politische
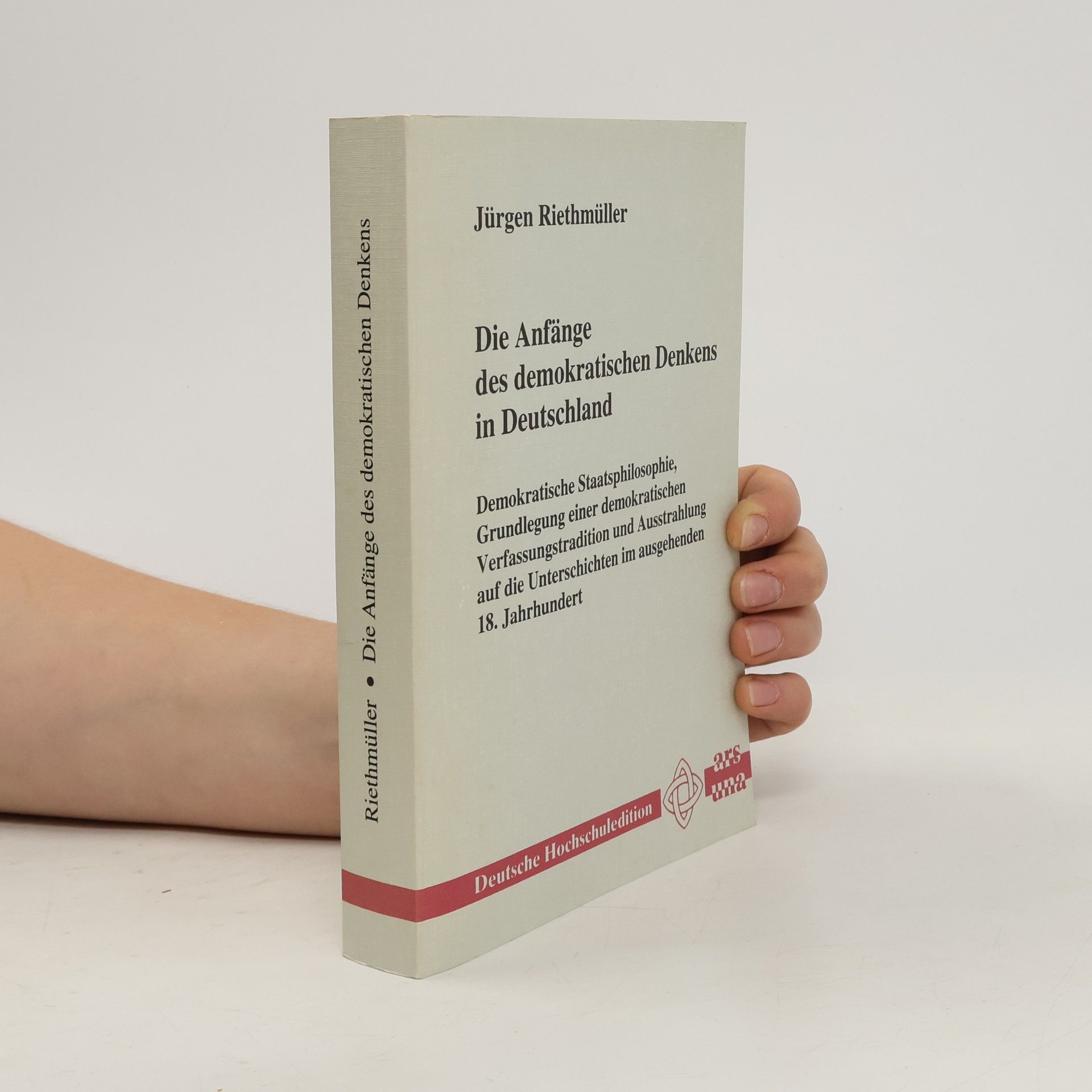
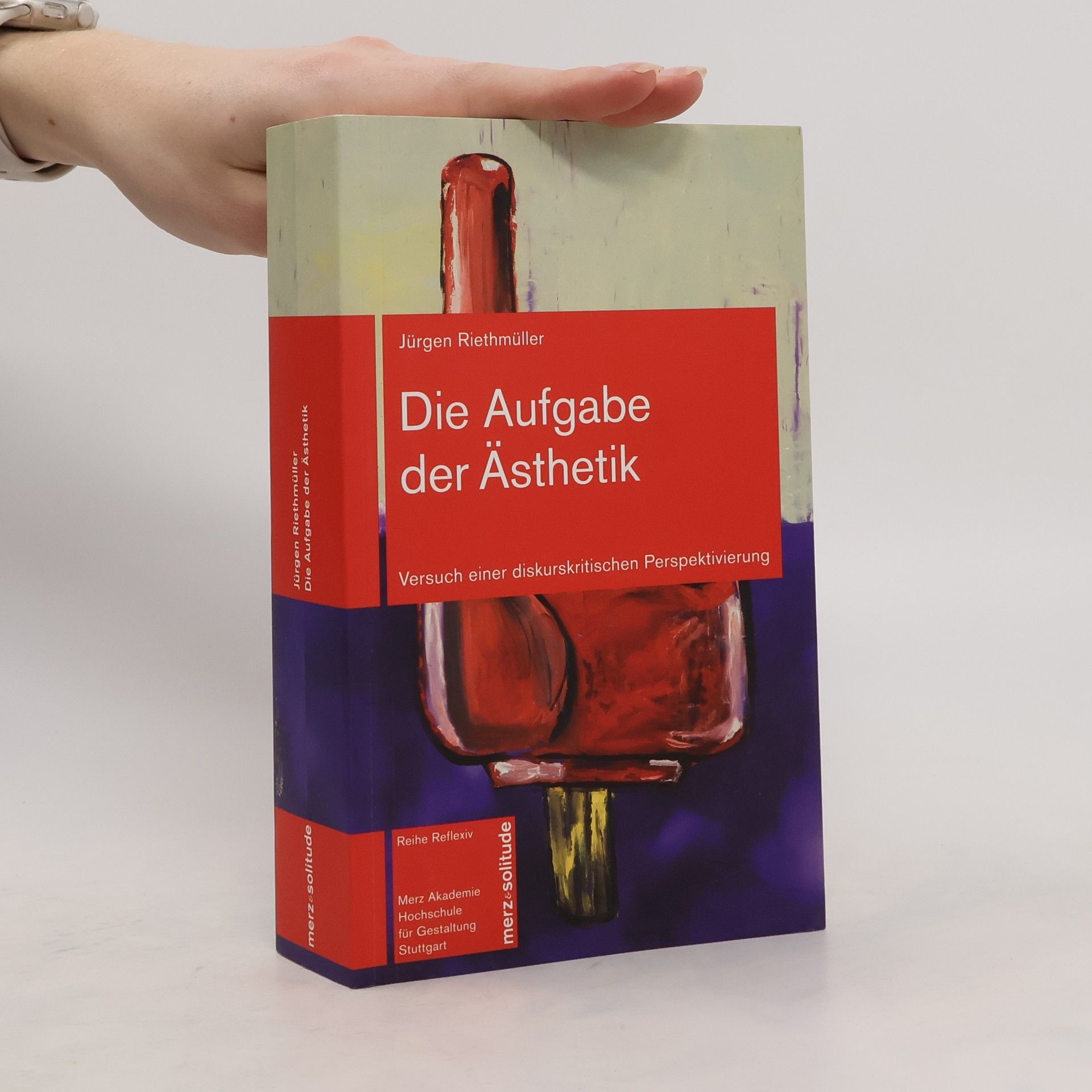

Der soziale Affekt und das Politische
Ästhetik hat sich heute in einem komplexen Spannungsfeld zwischen psychologischer Ästhetik, Kunsttheorie und normativer Philosophie etabliert. Heterogene Diskurse aus Kunst, Architektur, Musik, Theater, Philosophie, Psychologie und Design erweitern und verwirren die klassischen Theorien. Während einige von einem ästhetischen Wandel in den Kulturwissenschaften sprechen, proklamieren andere das „Ende der Ästhetik“. Daher ist es notwendig, dass sich die Ästhetik mit ihrem eigenen diskursiven Rahmen beschäftigt, insbesondere damit, wie „Kunst“ darin erzeugt wird. Die Arbeit unternimmt eine kulturtheoretische Bestandsaufnahme des Problemfelds, gestützt auf klassische und neuere Ansätze der Philosophie, Psychologie und Systemtheorie. Ästhetik wird als Wissenschaft der Beurteilung und Beurteilbarkeit der sinnlich wahrnehmbaren Welt verstanden, wobei das Urteil auf deren streitbare Qualität abzielt. Vermeidet man Verengungen auf Kunst oder das Schöne, zeigt sich die immense Relevanz der Ästhetik in epistemologischer und demokratietheoretischer Hinsicht. Der ästhetische Blick ist zentral für die subjektive Welterzeugung und eine kritische Analyse kann auf die impliziten ästhetischen Dimensionen in Wissensformationen hinweisen. Die Untersuchung beobachtet eine schleichende Aufgabe der Ästhetik, während eine ästhetische Reflexion vermisst wird, gerade in Zeiten neuer technologischer Herausforderungen. Dr. Jürgen Riethmüller lehrt an der