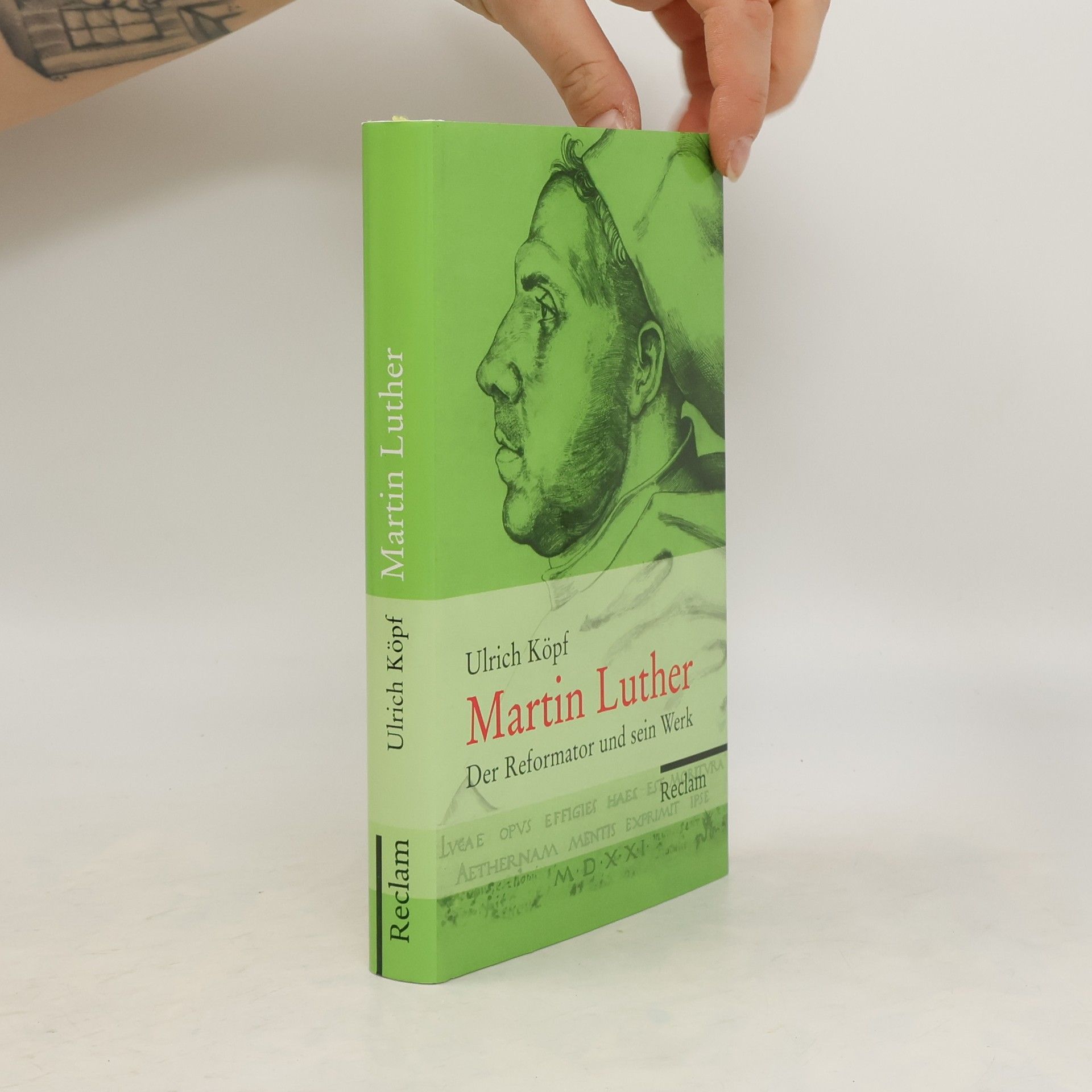Kulturkontakte und Rezeptionsvorgänge in der Theologie des 12. und 13. Jahrhunderts
- 396 stránek
- 14 hodin čtení
Die Rezeption vor- und außerchristlicher Gedanken ist ein zentraler Vorgang in der Geschichte der christlichen Theologie. Einen Höhepunkt erlebte sie im 12. und 13. Jahrhundert, als die Kontakte zwischen christlich-abendländischer und byzantinischer, jüdischer und islamischer Kultur den Boden für das Bekanntwerden, die Übersetzung und die Übernahme bisher unzugänglicher oder gar unbekannter Traditionen schufen. Im vorliegenden Band wird in Überblicksdarstellungen und in Spezialstudien die Rezeption eines christlichen Platonismus aus Pseudo-Dionysius Areopagita, des gesamten Opus Aristotelicum sowie jüdischer und islamischer Traditionen behandelt. DabeI wird auch deutlich, dass diese verschiedenen Traditionskomplexe im Mittelalter nicht isoliert, sondern in enger Beziehung zueinander überliefert und rezipiert worden sind.