Detlef Döring Knihy
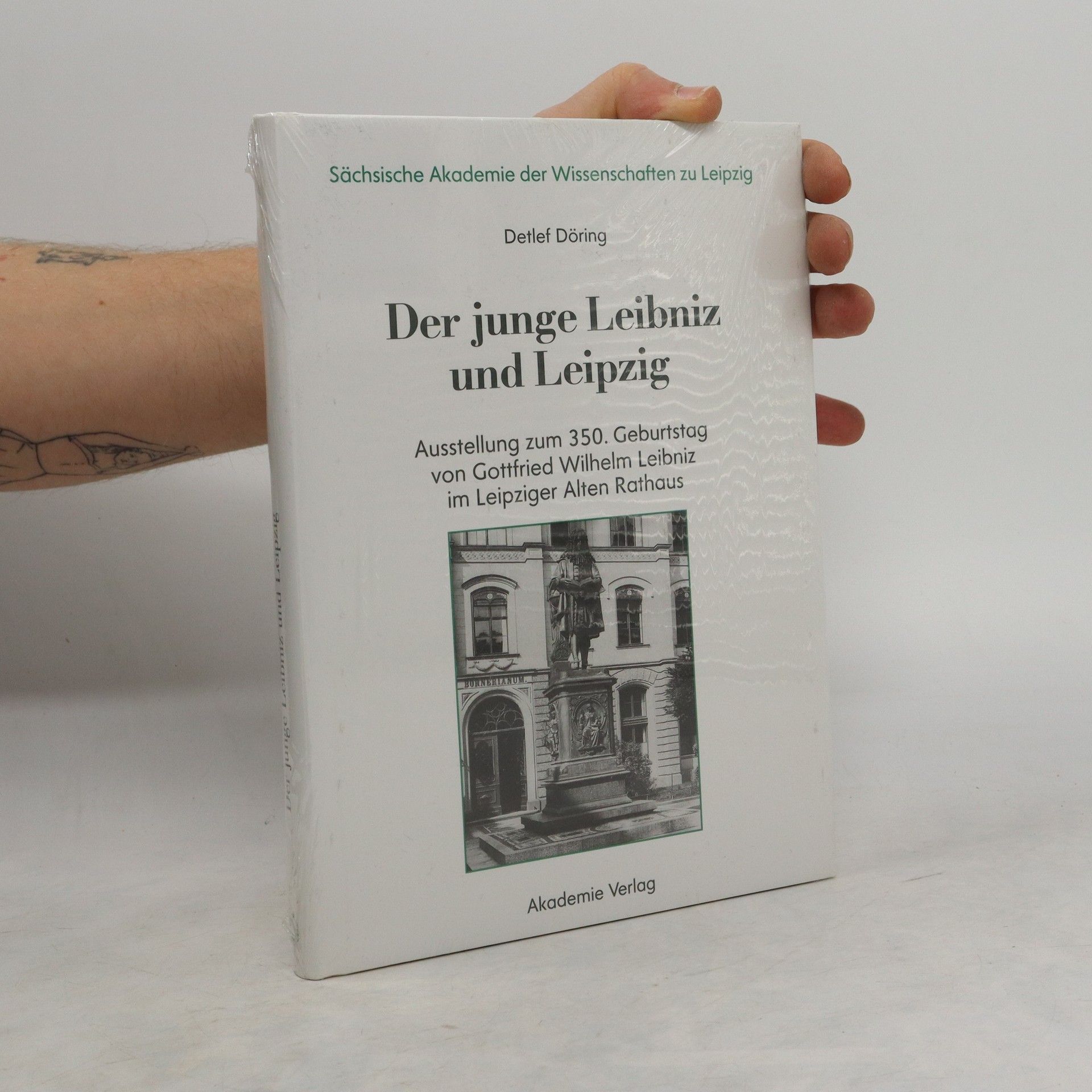
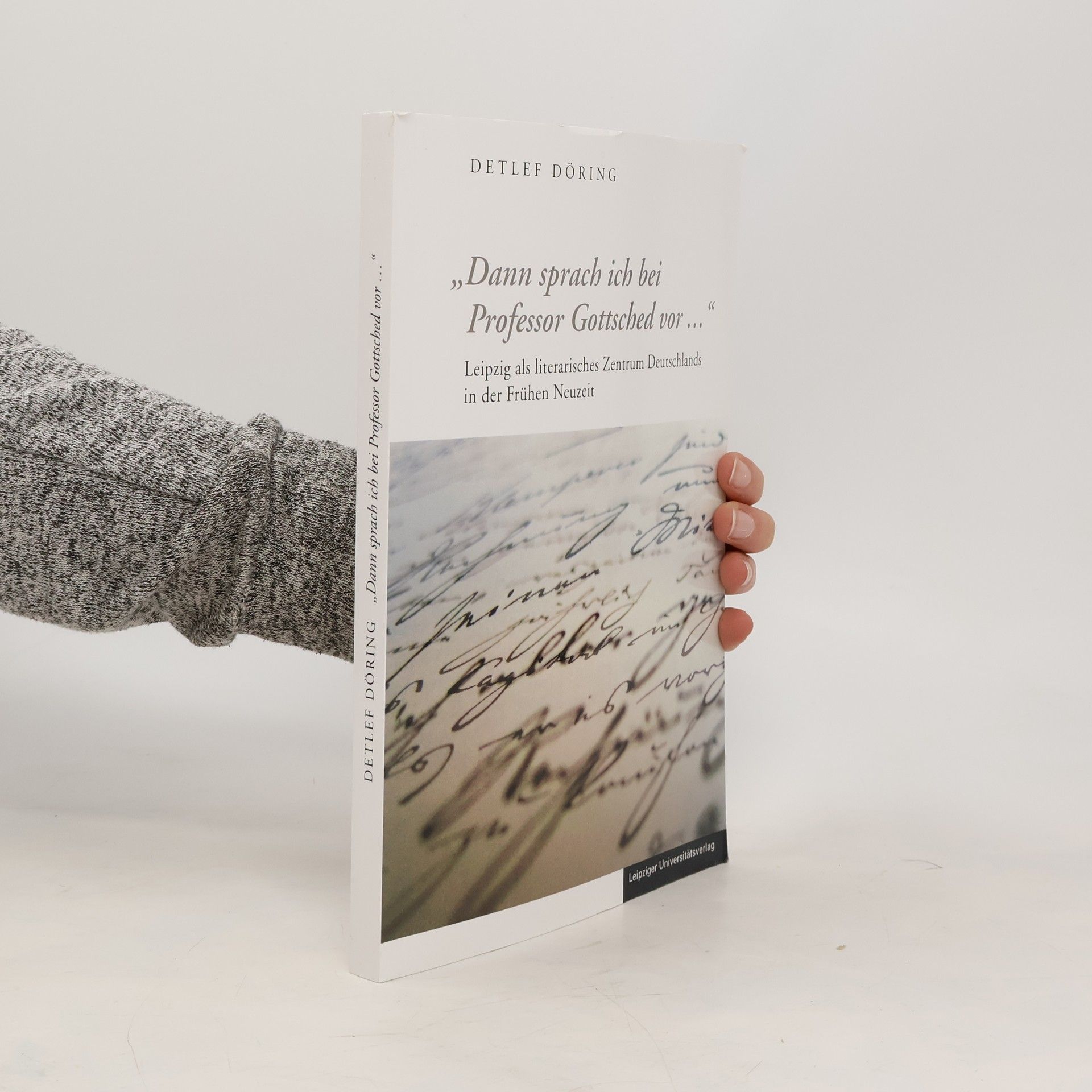
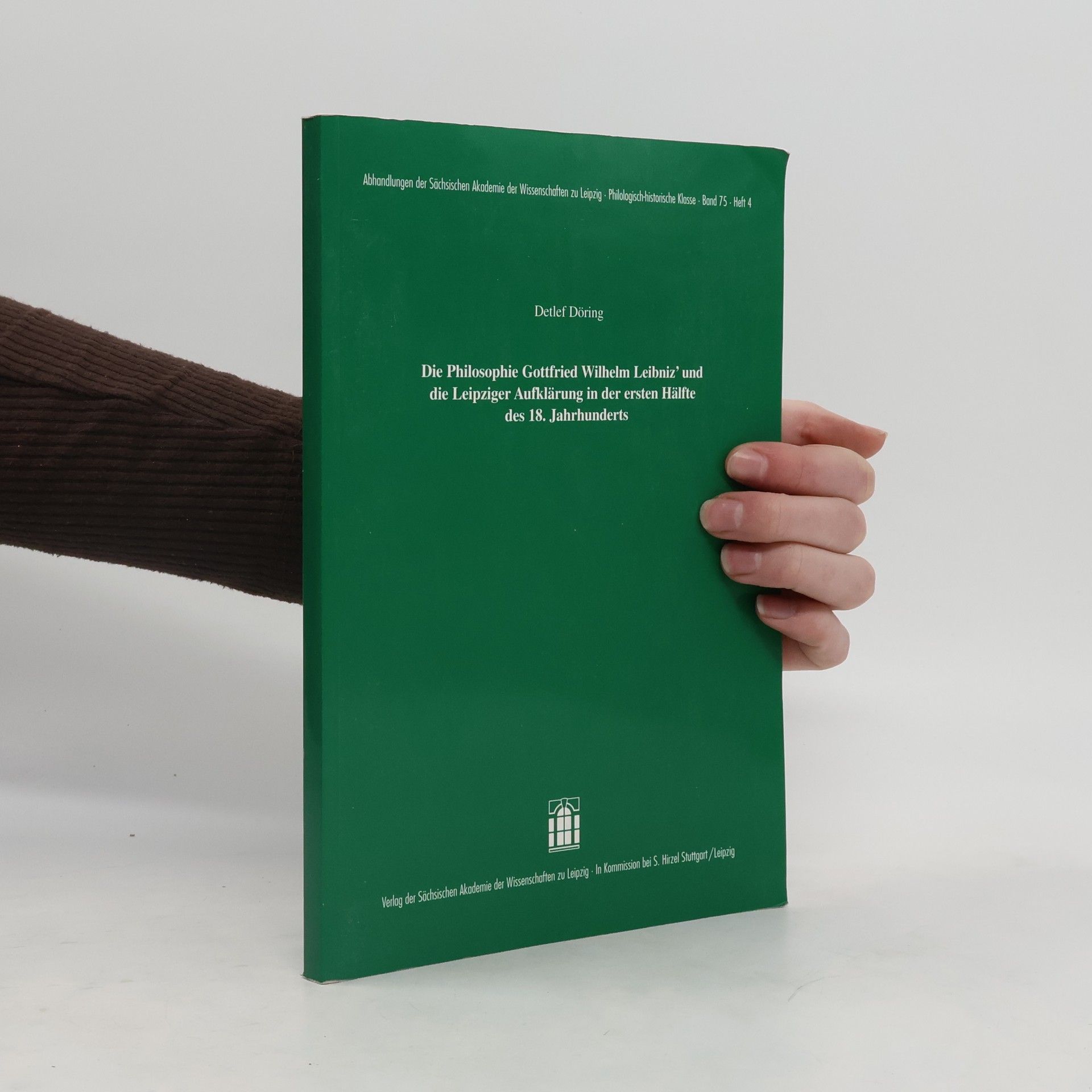


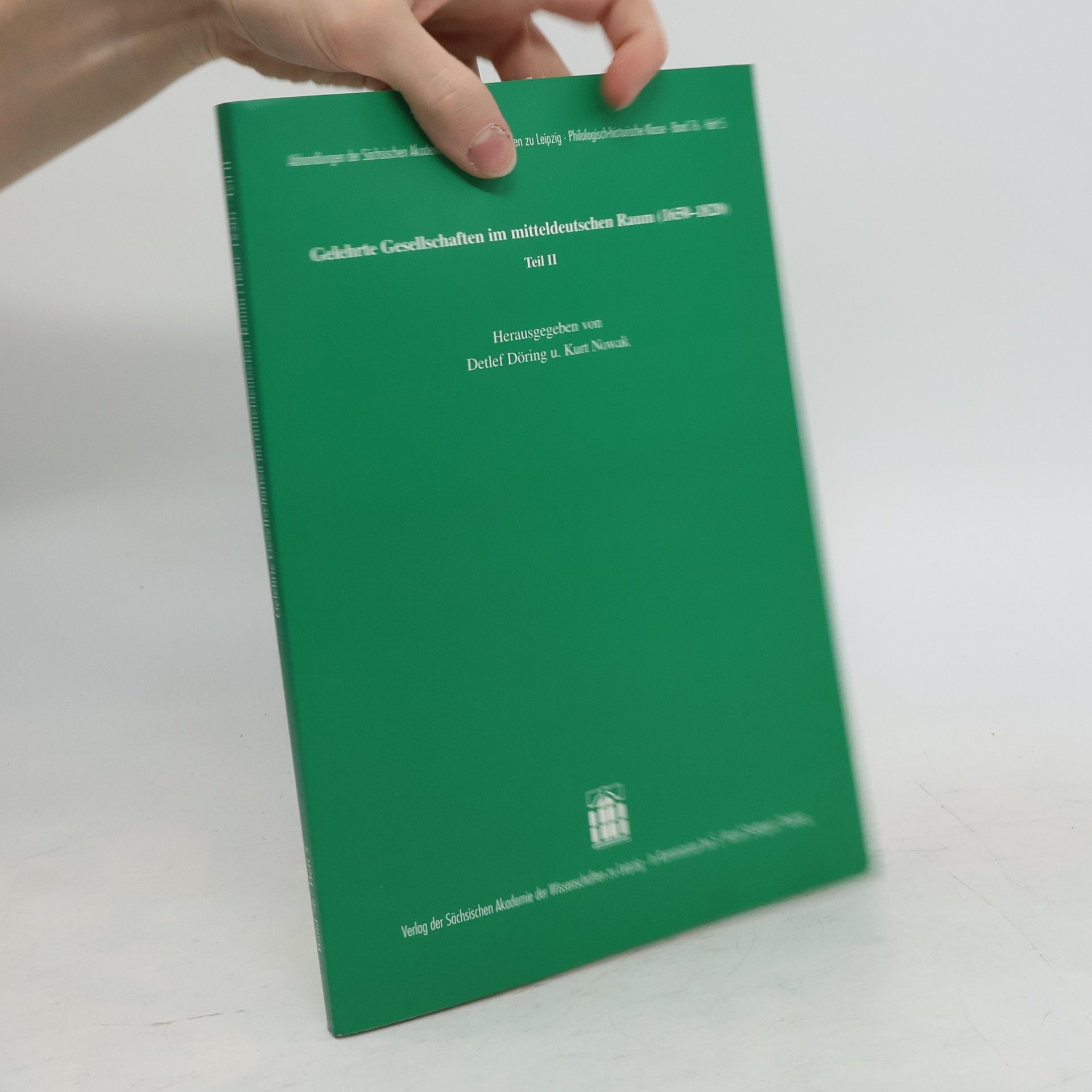
Anlässlich der 300. Wiederkehr des Geburtstages von Johann Christoph Gottsched (1700-1766) gestaltet die Sächsische Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Leipziger Universität eine Ausstellung, die an Gottscheds mehr als vierzigjährige Wirkungszeit in Leipzig erinnert. Der Katalog zu dieser Ausstellung vermittelt im ersten Teil einen Überblick über die äußeren Bedingungen für das Auftreten Gottscheds: das Gesicht der Stadt, ihre Bewohner, das kulturelle und wissenschaftliche Leben. Dabei wird der Universität besondere Beachtung geschenkt. Der zweite Abschnitt widmet sich Gottscheds Biographie in ihrer Verbindung mit Leipzig. Es folgt eine Darstellung der wichtigsten Bereiche des Wirkens von Gottsched: Philosophie, Publizistik, Sozietäten, Theater, Naturwissenschaften, Hochschulpolitik. Eine ausführliche Beschreibung der Exponate vertieft und erweitert die im Textteil gebotenen Ausführungen. Am Beispiel Gottscheds zeichnet so der Katalog ein Bild Leipzigs zu einer Zeit, in der die Stadt den vielleicht wichtigsten kulturellen Mittelpunkt ganz Deutschlands bildete.
Dass sich die vorliegende Darstellung gleichwohl auf die Philosophie beschränkt, hat einen äußeren Grund: Niemand ist heutzutage in der Lage, alle Wissenschaften in ihrer historischen Entwicklung zu beherrschen. Zum anderen bildet die Philosophie doch den Mittelpunkt des Werkes von Leibniz. Zudem steht sie in den Jahrzehnten nach seinem Tod im Zentrum der Diskussion innerhalb und weithin außerhalb der Universitäten. Dies gilt für die gesamte Hälfte der Aufklärung, also bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinweg.
"Dann sprach ich bei Professor Gottsched vor ..."
Leipzig als literarisches Zentrum Deutschlands in der Frühen Neuzeit
- 208 stránek
- 8 hodin čtení
Die Studie von Detlef Döring zielt darauf ab, ein umfassendes Panorama des literarischen Lebens in Leipzig zwischen dem späten Mittelalter und der frühen Romantik zu entwerfen. Im Gegensatz zu Darstellungen, die sich auf herausragende literarische Leistungen konzentrieren, stehen hier die Personenkreise, sozialen Schichten und Institutionen im Mittelpunkt, in denen Literatur entstand. Es wird untersucht, wie literarisches Schreiben und Publizieren eng mit der Geschichte Leipzigs und den spezifischen Bedingungen der Literaturproduktion verknüpft sind. Ziel ist es, die Besonderheiten der Leipziger Literaturhistorie im Kontext der geistesgeschichtlichen Entwicklungen sichtbar zu machen. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass die bisher überwiegend negative Beurteilung der Leipziger Literaturproduktion um 1800 einer Korrektur bedarf. Der Band versteht sich als Beitrag zum 1000. Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung Leipzigs und regt dazu an, die reichen Traditionen der Stadt in Kultur-, Literatur- und Wissenschaftsgeschichte intensiver zu erforschen und einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln.
Der junge Leibniz und Leipzig
- 189 stránek
- 7 hodin čtení