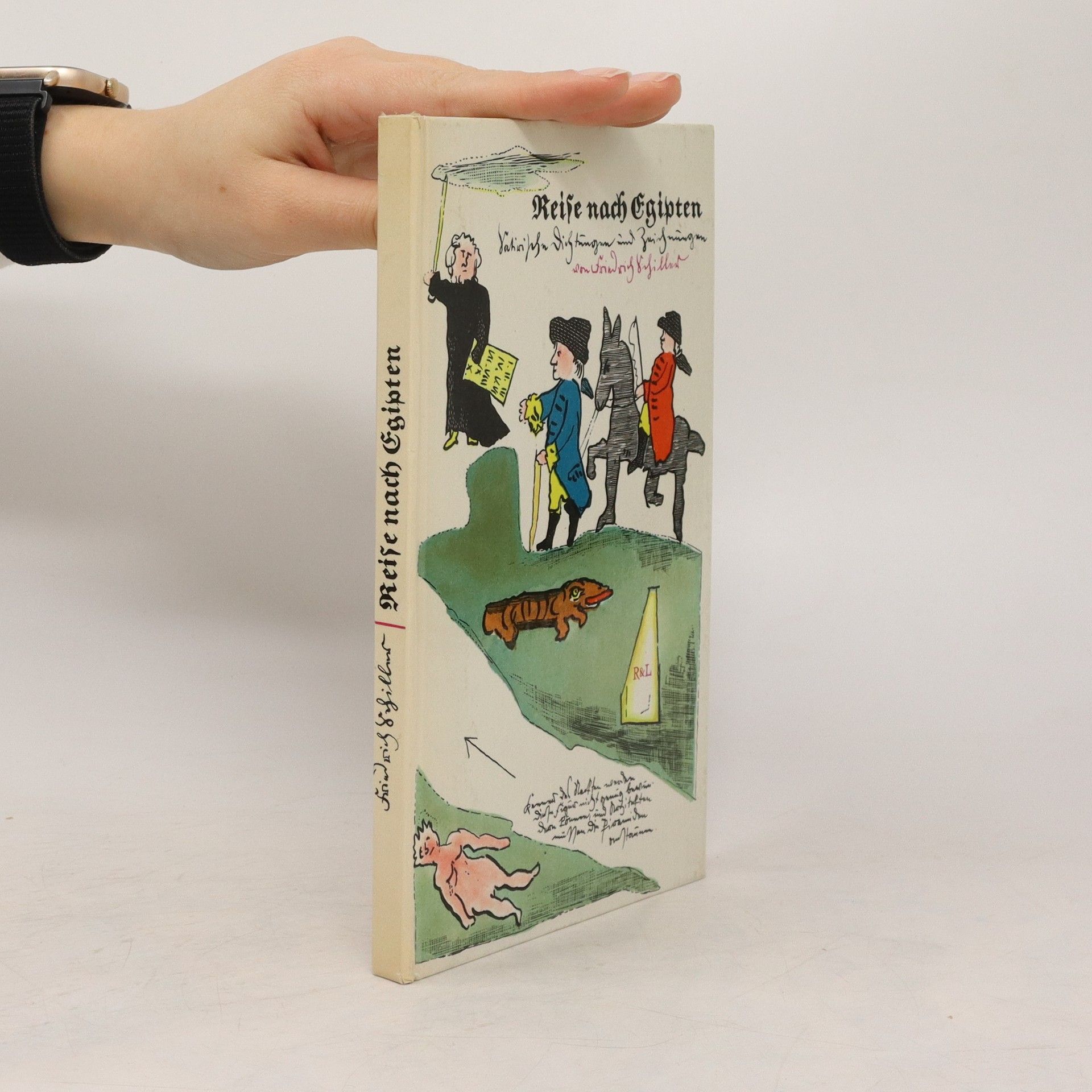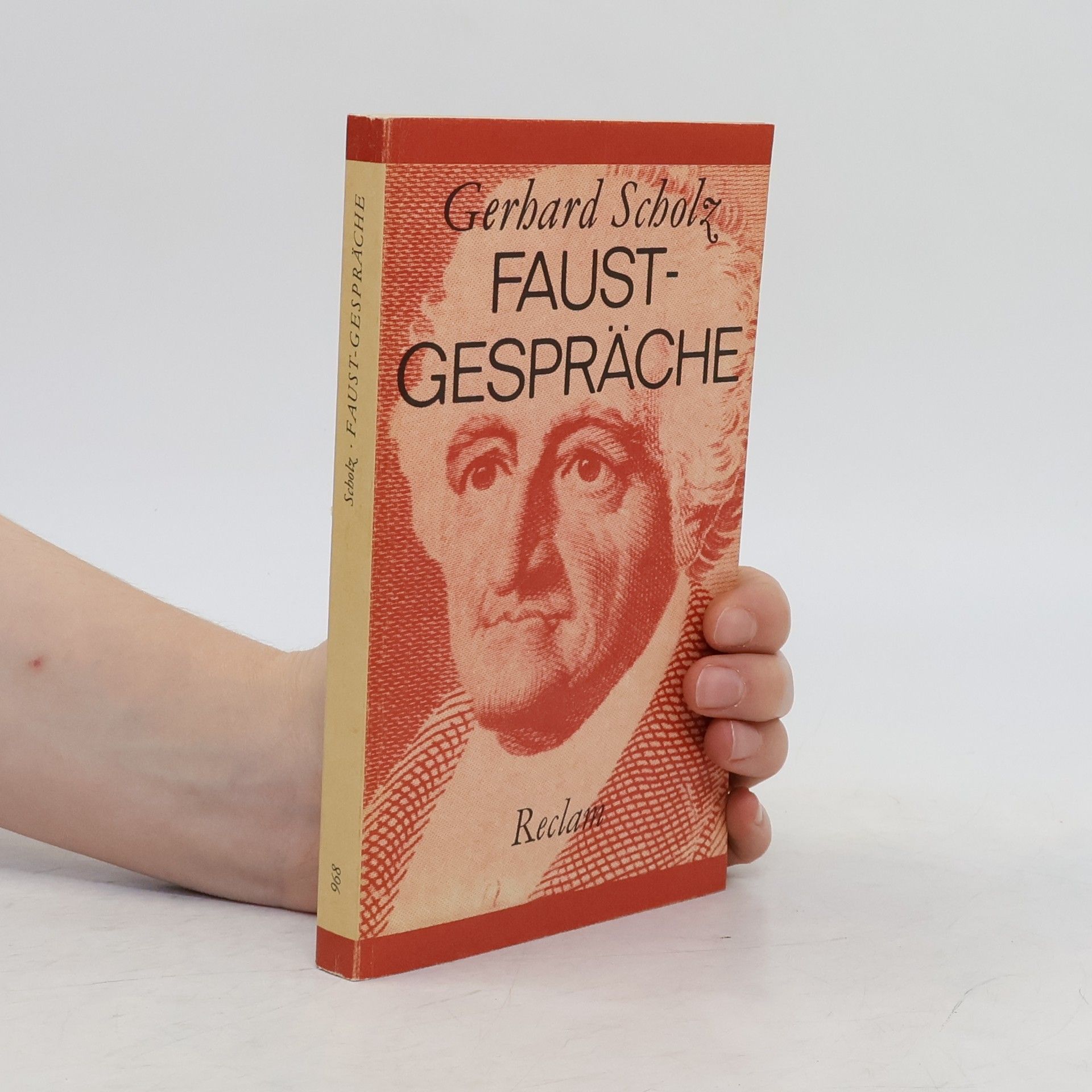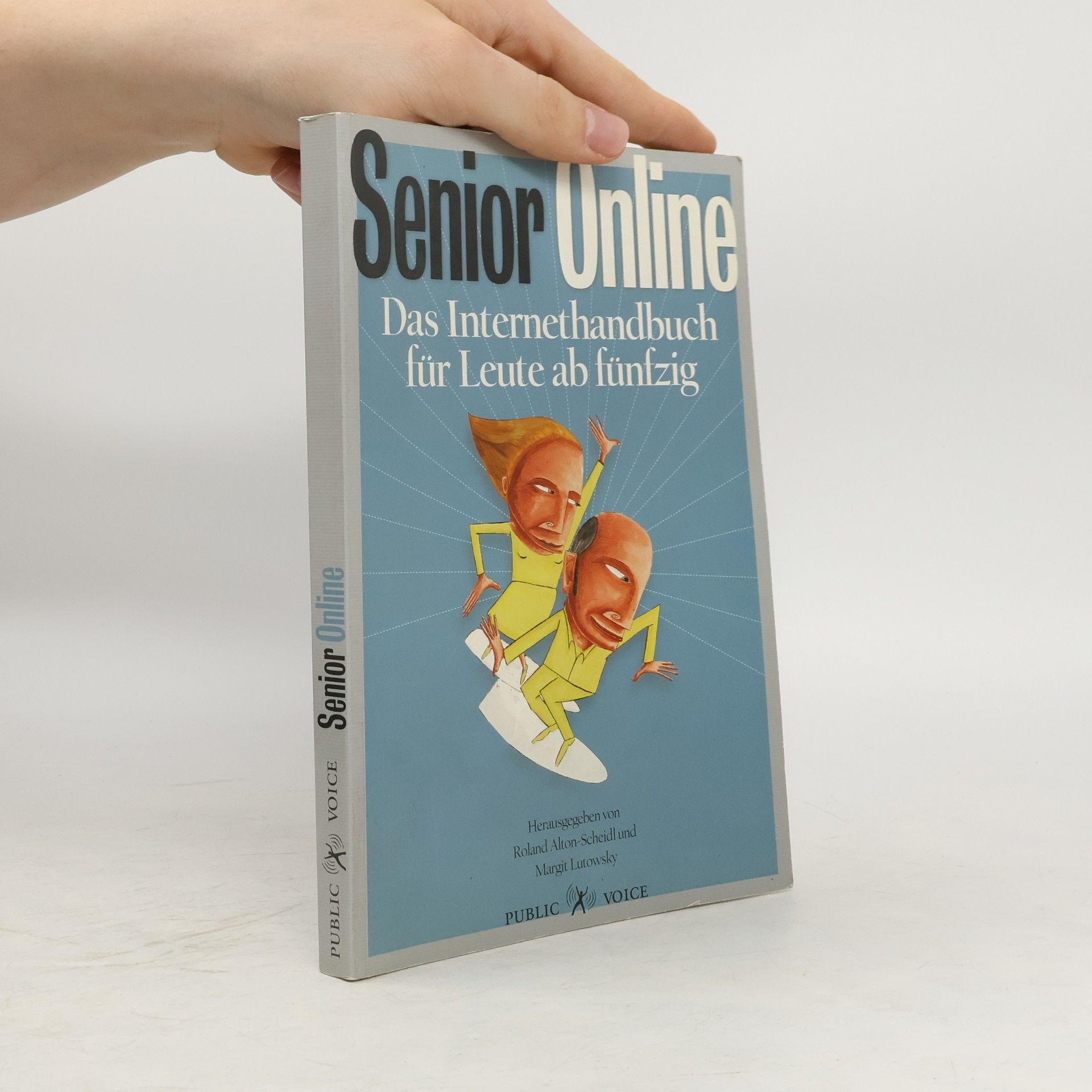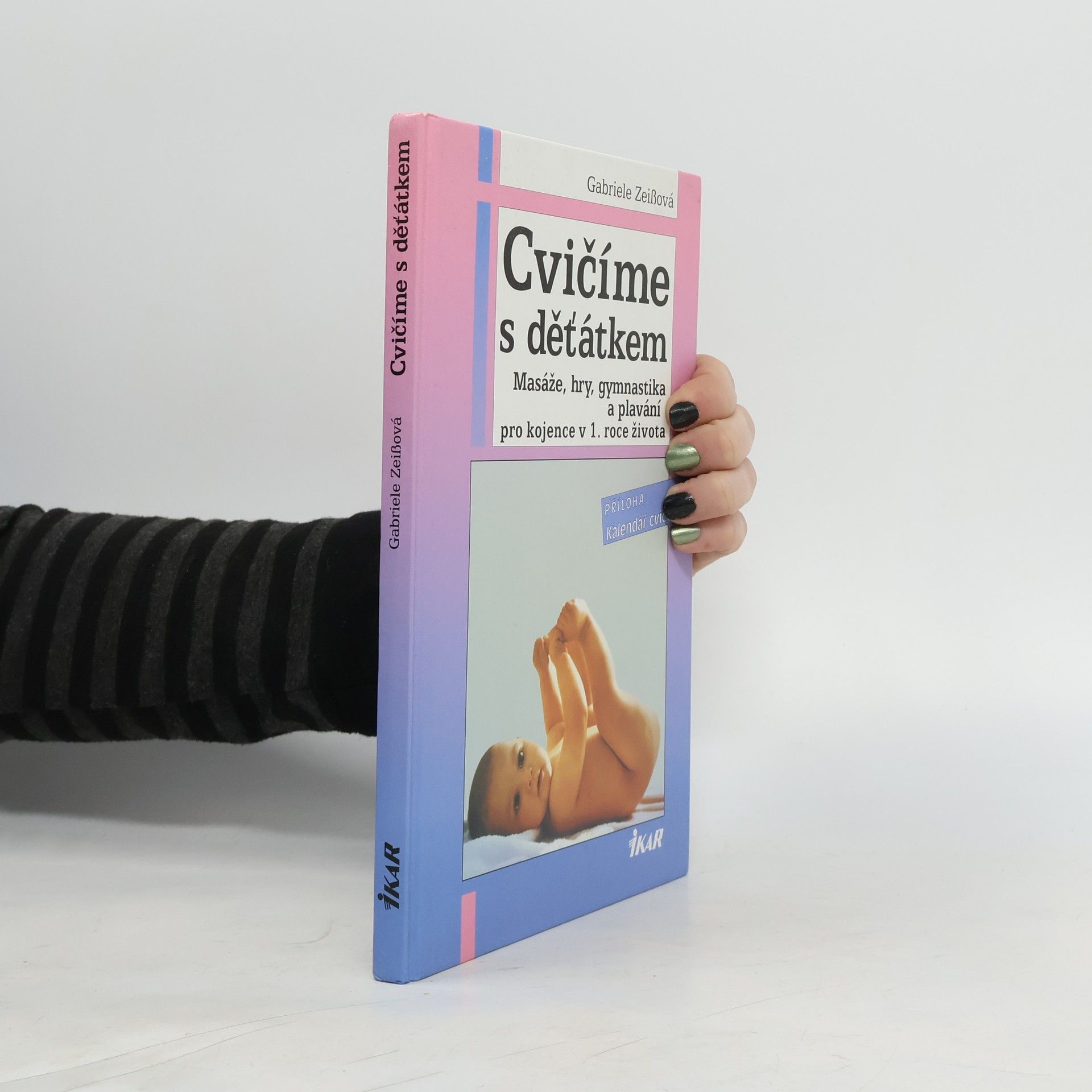Jak překonávat meze po endoprotéze
- 40 stránek
- 2 hodiny čtení
Kniha německého autora je určena všem, kteří se rozhodují, zda podstoupit operaci kyčelního kloubu a jeho náhradu endoprotézou. Autor poutavě vypráví, jak a proč se u něj nemoc objevila, popisuje své úvahy a nápady, jak se s nemocí vypořádat, svá hledání různých alternativních způsobů léčby a shrnuje i všechny důvody, proč se nakonec rozhodl jít na operaci. Následně seznámí čtenáře s odpověďmi na nejčastější otázky pacientů a kniha obsahuje i zcela praktické rady, týkající se následujícího života s endoprotézou, například, zda je rozumné se věnovat cyklistice, či jakým směrem si sedat v hromadné dopravě. Autor nezahlcuje čtenáře odbornými lékařskými termíny, ale s humorem a nadhledem pomůže každému čtenáři, který uvažuje, zda jít na operaci, se správně rozhodnout. Zvláště starší čtenáři pak jistě přivítají i dobrou čitelnost a přehlednost textu knihy.