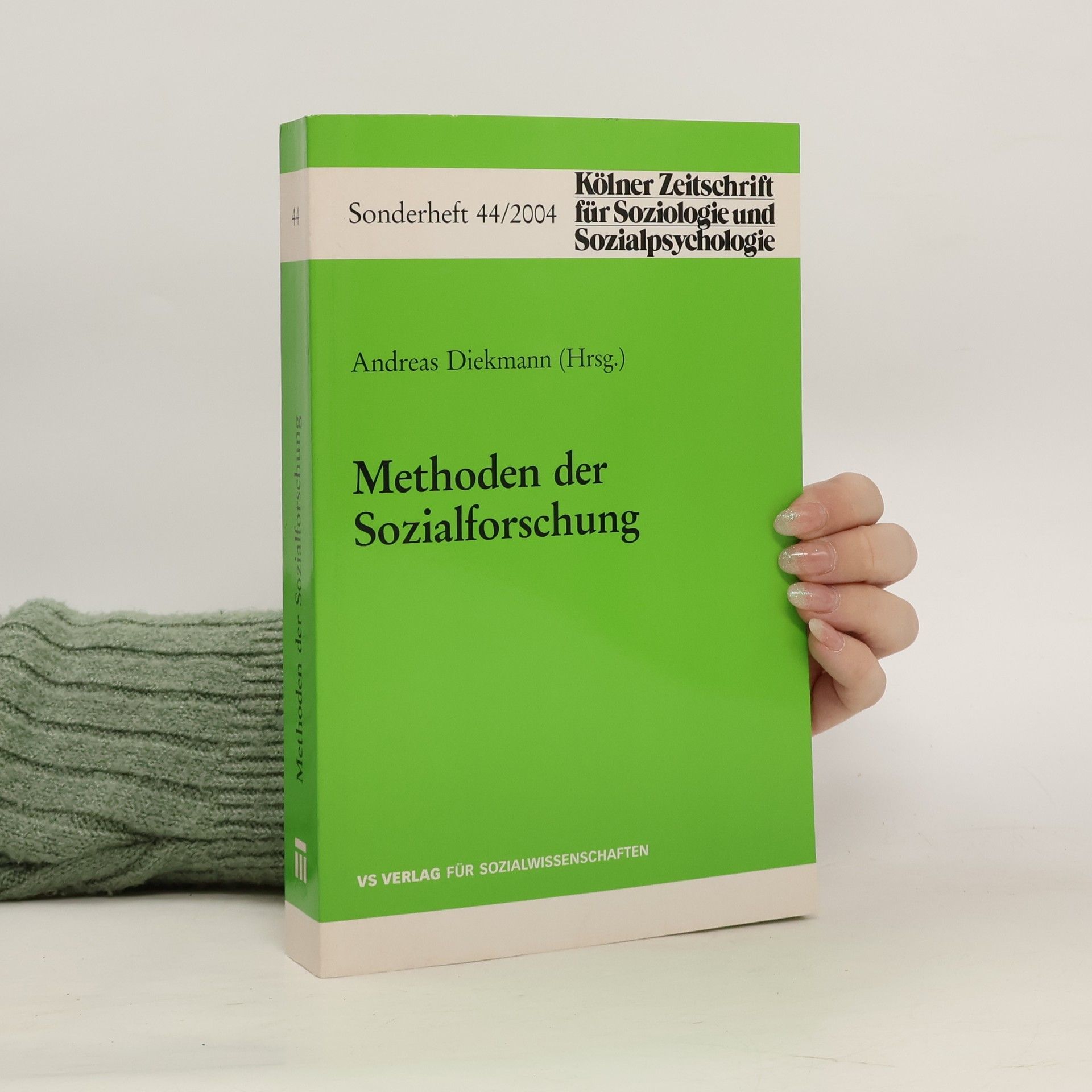Empirische Sozialforschung
Grundlagen, Methoden, Anwendungen
Diese Neuausgabe behandelt grundlegende Methoden der modernen empirischen Sozialforschung. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Untersuchungstechniken werden kritisch herausgearbeitet und an zahlreichen Beispielen aus der Forschungspraxis illustriert. Im Mittelpunkt dieses Lehrbuchs stehen:Untersuchungsplanung - Stichproben - Messung und Skalierung von Einstellungen - Querschnitts-, Panel- und Kohortenstudien - experimentelle und quasieexperimentelle Designs - persönliche, telefonische, schriftliche und Online-Befragung - Inhaltsanalyse - Feldexperimente und weitere Methoden der Datenerhebung - Datenanalyse.Die Kenntnis dieser Methoden, die praktisch in allen sozialwissenschaftlichen Disziplinen verwendet werden, aber auch in der Markt-, Meinungs-, Wahl- und Medienforschung sowie in den statistischen Ämtern, ist unerlässlich für jeden, der sich mit Daten und Zahlen gesellschaftlicher Entwicklungen und Zusammenhänge auseinandersetzt.