Etnicita a nacionalismus v diskurzu 20. století
- 242 stránek
- 9 hodin čtení
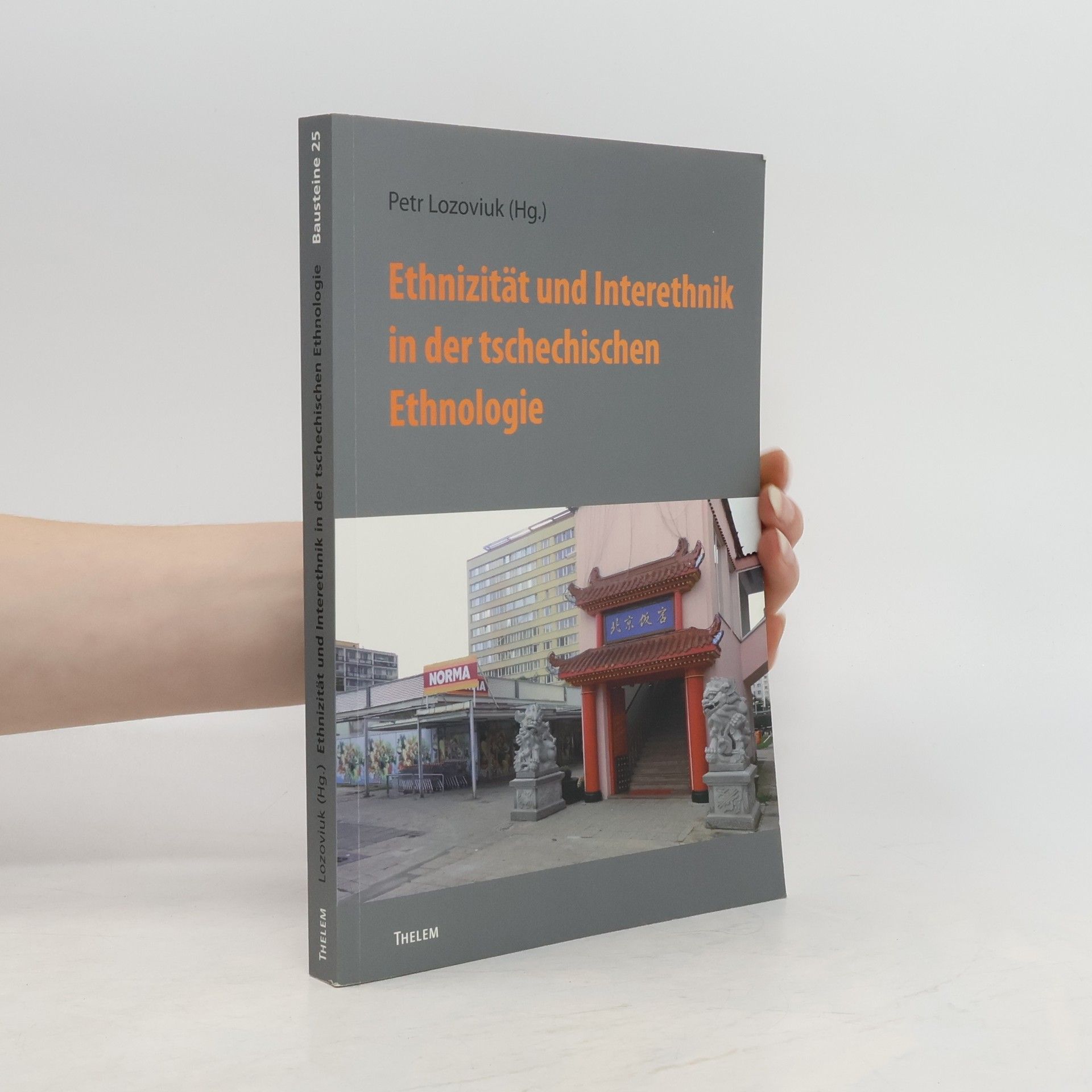

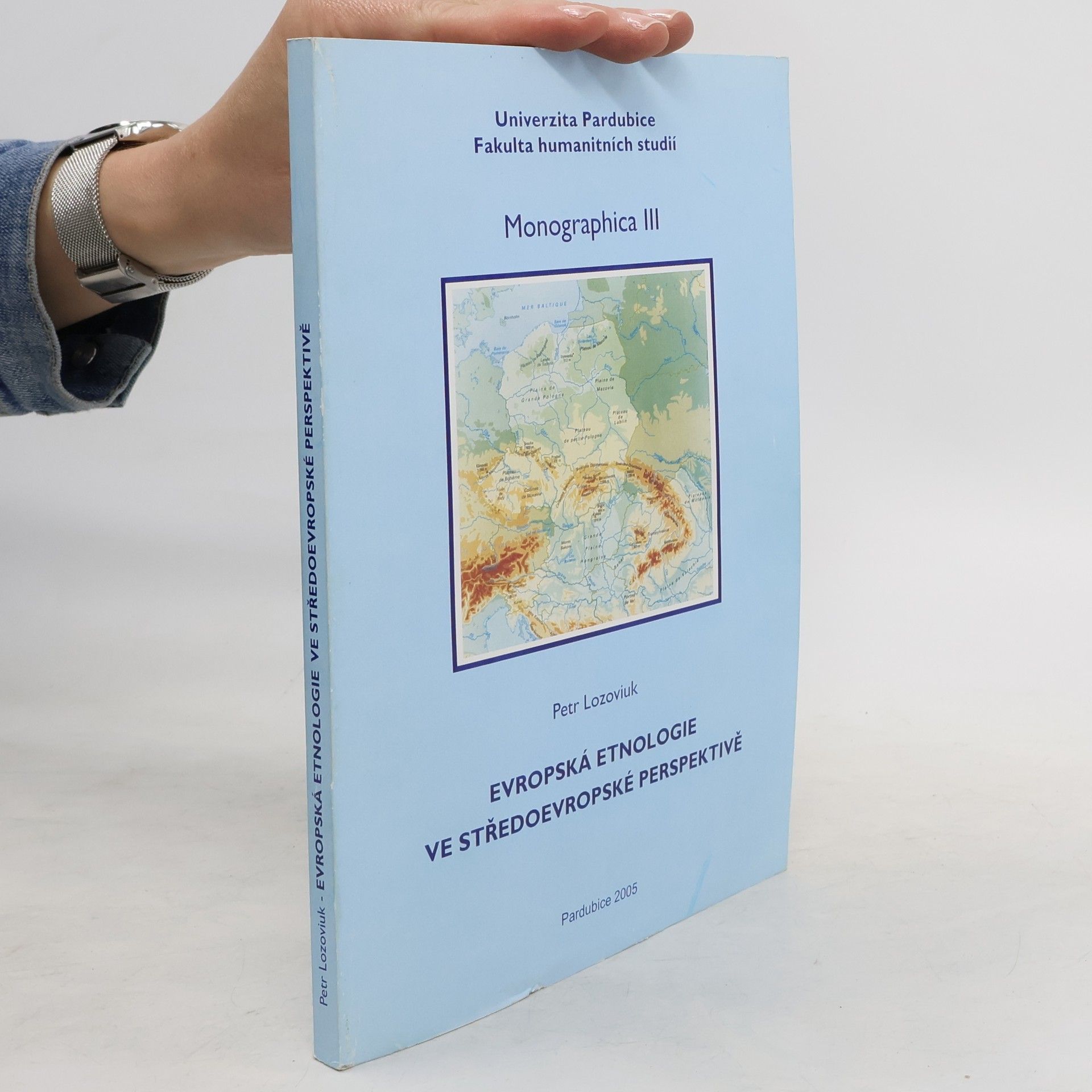

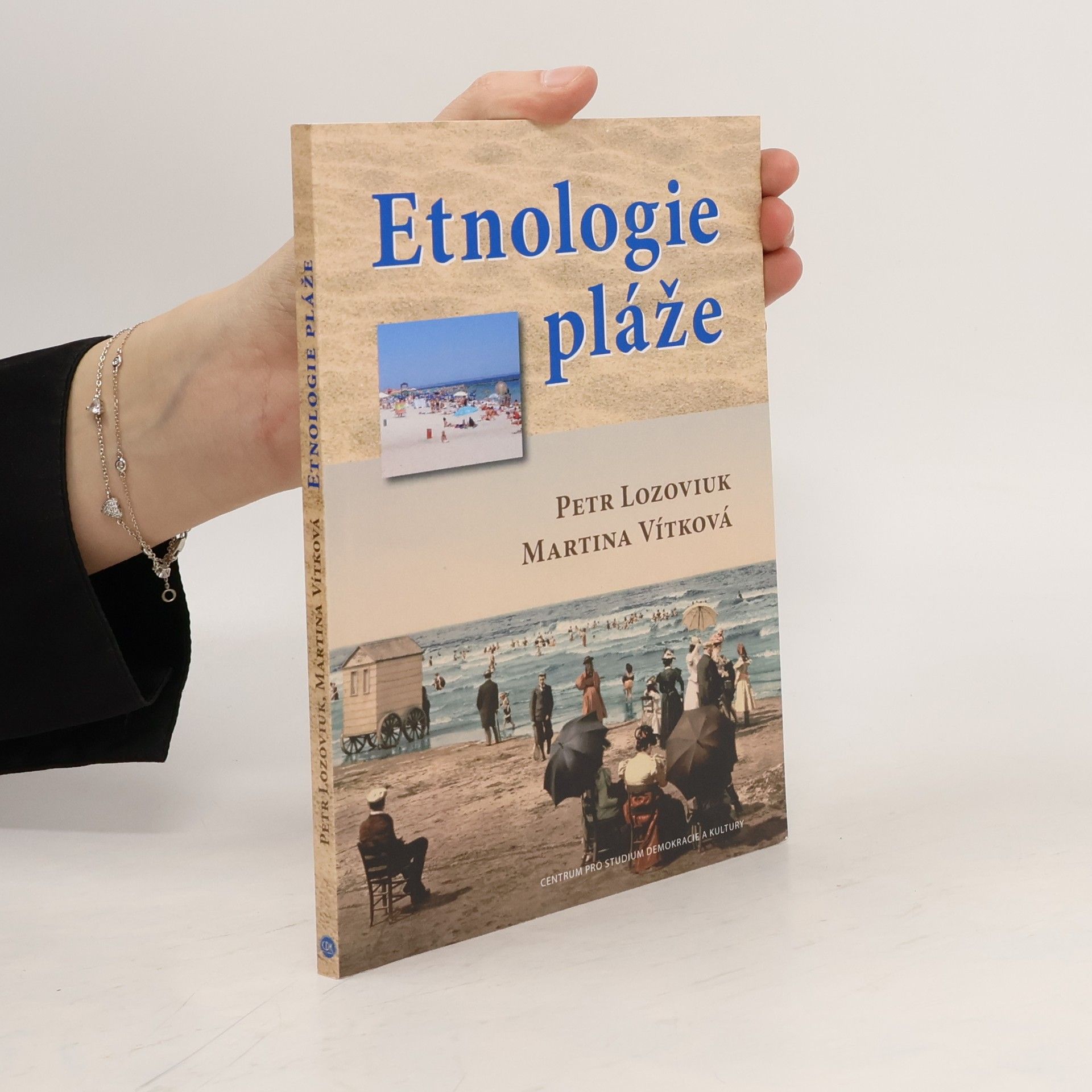

Pláž je produktivním prostředím pro reflexi různých společenských procesů a fenoménů. Není jen místem rekreace, ale osobitým sociálním prostorem, kde se projevuje odlišné vnímání tělesnosti a specifická pravidla chování. Slouží jako místo pro kumulaci sociálního kapitálu, prestiže, obživných aktivit a formy komunikace, ale také konfliktů. Vyznačuje se vysokou mírou komunikace, přičemž dominantní je neverbální projev, v němž hraje klíčovou roli lidské tělo. Pláž kombinuje environmentální a sociální aspekty, kde se prolínají osobní intimita a veřejně tolerované chování. Tento prostor přetváří vnímání kontroly sociálního jednání a pravidel, kdy to, co je jinde nepřípustné, může být zde akceptováno. Zatímco veřejný prostor funguje jako „scéna“ a soukromí jako „zákulisí“, pláž spojuje obě tyto charakteristiky. Autoři argumentují, že tyto myšlenky rozvíjí „etnologie pláže“, oborový příspěvek zaměřený na reflexi kultury všedního dne.
Monografie etnoložky a historičky a etnologa z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni představuje originální pohled na protektorát Čechy a Morava prizmatem propagandy. Ta sehrávala dvojí roli: obyvatelům vnuceného státního útvaru předkládala v celostní a srozumitelné podobě svůj zcela závazný světonázor a současně sloužila k pacifikaci společnosti. Kniha analyzuje osy této propagandy: vztah k Evropě a evropanství, poměr k českým dějinám a likvidační reflexi Židů. Pozornost je přitom věnována jak propagandistickému dějepisectví a pseudohistoriografii, tak politickému národopisu, který v jistých ohledech navazoval na starorakouskou a meziválečnou sudetoněmeckou tradici. V obecné rovině jde pak o text, jenž ukazuje postupy při likvidaci liberálních narativů ve společnosti.
Kniha představuje výsledky výzkumu srovnávací etnologie (především) zemí střední Evropy.
Die Präsentation von ethnischen bzw. nationalen Minderheiten sowie interethnisch geprägten Regionen gehört seit Jahren zum wichtigen Bestand musealer Arbeit. Im vorliegenden Band werden die „Minderheitenmuseen“ als spezifischer Typus einer wissensvermittelnden Institution wahrgenommen und in den Fokus der wissenschaftlichen Diskussion gerückt. Vergleichend wird gezeigt, wie unterschiedlich oder auch ähnlich die methodischen und theoretischen Zugänge auf diesem Gebiet in verschiedenen Museen in diversen europäischen Ländern sein können. Besondere Aufmerksamkeit gilt der jeweiligen Konzeption, der Museumsgeschichte, den Zugangsweisen bei der Präsentation, aber auch den an das Publikum gestellten Erwartungen. Ferner werden theoretisch orientierte Problemkreise thematisiert, wie z. B. die Frage der identitätsstiftenden Funktion des auf eine Minderheit orientierten Museums für die jeweilige Zielgruppe. Der Sammelband setzt sich ferner zum Ziel, aus den Parallelen und Unterschieden in der musealen Arbeit Anregungen für ein weiteres Nachdenken über die dargestellten Visualisierungsformen zu gewinnen.
Die Untersuchung der sogenannten ethnischen Prozesse und der Kollektividentitäten der ethnischen Minderheiten in der Tschechoslowakei und der im Ausland lebenden Tschechen gehört seit Jahrzehnten zu den Hauptthemen der tschechischen Nachkriegsethnografie. Die politische Wende von 1989 führte jedoch auf diesem Gebiet zu umfangreichen Veränderungen, die sowohl durch die Abwendung von der marxistischen Ethnos-Theorie als auch durch die thematische Erweiterung der ethnisch definierten Problematik gekennzeichnet waren. Der Sammelband stellt sich die Aufgabe, das deutschsprachige Publikum über diese Entwicklung in der tschechischen Ethnologie zumindest punktuell zu informieren. Um die innere Wandlung des Faches in Tschechien in den letzten 20 Jahren zu veranschaulichen, wurde besonderer Wert auf die Auswahl von einerseits namhaften Autoren und andererseits von gängigen Themen gelegt. Im Unterschied zu einigen anderen „kleinen“ ethnologischen Traditionen Europas liegt bisher kein vergleichbares „Lesebuch“ in deutscher Sprache vor. Der Band entstand im Rahmen eines grenzübergreifenden Projektes, das das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. in Dresden gemeinsam mit der tschechischen gemeinnützigen Gesellschaft Collegium Bohemicum aus Ústí nad Labem realisiert.
Im Zentrum des Buches steht die Frage, welche mentalen Konstruktionen die Existenz der politischen Grenze hervorruft und welche konkreten Auswirkungen diese auf das Alltagsleben der Grenzlandbewohner ausübt. Das analysierte ethnografische Material wurde auf beiden Seiten der sächsisch-tschechischen Grenze in zwei durch die politische Grenzziehung geteilten Orten erhoben. Neben der historischen Darstellung der grenznahen Alltagsrealität richtet sich die Aufmerksamkeit auf die nach 1989 entstandene Situation. Gestützt auf die im Grenzland geführten Interviews bemüht sich die Studie, aus der Perspektive ausgewählter lebensweltlicher Dimensionen die Frage zu beantworten, wie die Grenzlandbewohner ihren Alltag arrangieren und inwieweit ihre Strategien der Alltagsbewältigung von der Existenz der staatspolitischen Grenze beeinflusst sind. Als relevant erwiesen sich in diesem Kontext zugleich die deutsch-tschechischen Beziehungen in ihrem spannungsreichen Wandel. Die hier präsentierten Resultate deuten an, dass der objektiv festzustellenden Relativierung der staatspolitischen Grenzen eine überraschend feste Beharrlichkeit der subjektiv erlebten Demarkationen gegenübersteht. Es ist deshalb gerechtfertigt, auch im vereinten Europa , ohne Grenzen‘ künftig mit Auswirkungen von intersubjektiv geprägten Eigen- und Fremdbildern zu rechnen.
Die Volkskunde in Böhmen gehört zu jenen Disziplinen, die bis vor kurzem im gesamtgesellschaftlichen Rahmen deutlich ideologische Implikationen aufwiesen und auch politische Konsequenzen hatten. Unter den Bedingungen eines sprachlich und national gemischt entwickelten Landes spielten die Volkskundler seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine immer bedeutendere Rolle. Im Vergleich zur Volkskunde in anderen deutschsprachigen Ländern zeichnete sich die deutschböhmische Volkskunde durch einige Besonderheiten aus. Zu den wichtigsten von ihnen gehört die landesspezifische Gestaltung des „Volkstumskampfes“, an dem zahlreiche Vertreter des Faches beiderseits der Sprachgrenze mehr oder weniger teilnahmen. Im Zentrum der Untersuchung stehen die Wechselbeziehungen zwischen der volkskundlichen Forschung und der Anwendung das auf diese Weise gewonnen Fachwissens zu ideologischen Zwecken. Besondere Aufmerksamkeit kommt hierbei der institutionellen Verankerung von volkskundlicher Forschung und Lehre an der Deutschen Universität in Prag zu. Thematisiert wird auch die Beziehung der deutschböhmischen Volkskunde zu der tschechischsprachigen volkskundlichen Tradition. Die Arbeit will nicht nur die Aufwertung des Faches und dessen Leistung im „nationalen Kampf“ in Böhmen kritisch summieren, sonder auch einen Beitrag zur aktuellen deutsch-tschechischen Diskussion leisten.
Die Beiträge dieses Bandes sind Resultat eines Workshops zum Thema 'Perspektiven und Problemen der ethnologischen Fachgeschichtsschreibung' am 26./27.11. 2004 am ISGV, der eine Reihe von Beiträgen zur Methodologie einer Fachgeschichtsschreibung präsentierte, die für die volkskundliche und ethnologische Diskussion von Interesse sind. Während viele Fachgeschichten bislang relativ deskriptiv Ergebnisse archivalischer Forschungen oder allenfalls noch eine Inhaltsanalyse vorgelegter Programmschriften darstellen, hatte ein Großteil der bei diesem Workshop präsentierten Projekte einen weiter reichenden Ansatz. Dabei sind fast alle Projekte noch in verschiedenen Stadien des Entstehens, was eine intensive Auseinandersetzung mit theoretischen und methodologischen Positionen notwendig macht und so einen konkreten Einblick in Forschungen zur Fachgeschichtsschreibung ermöglicht.