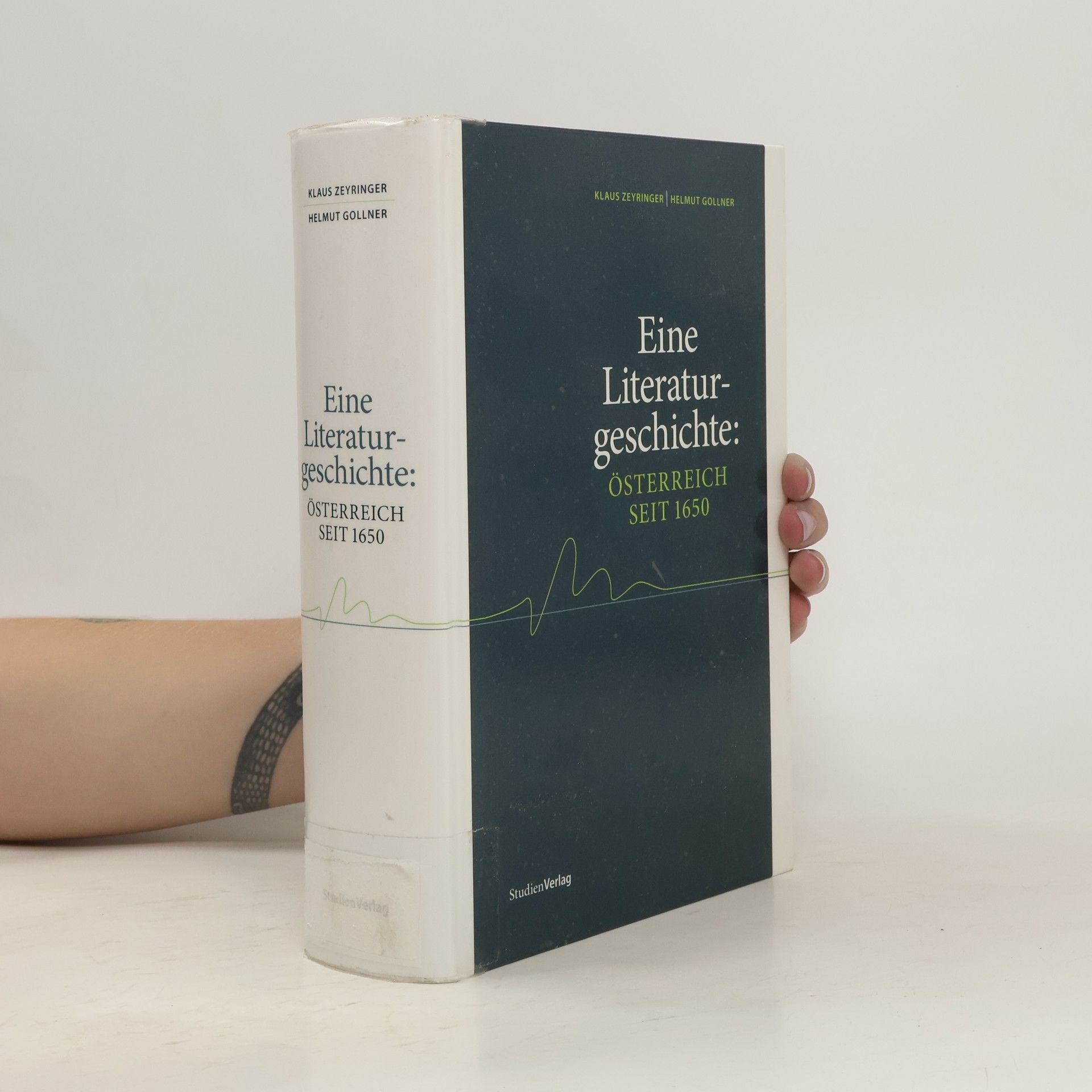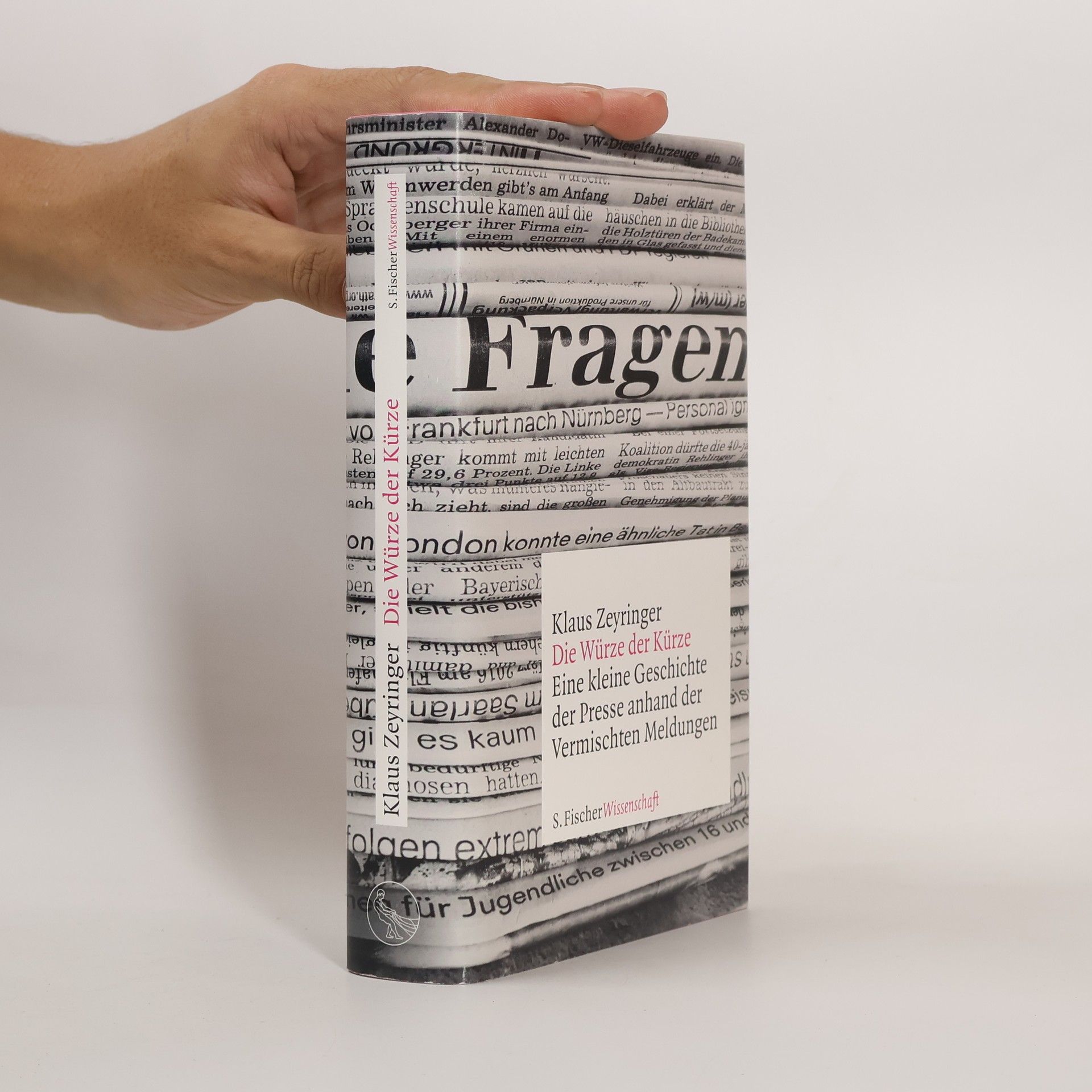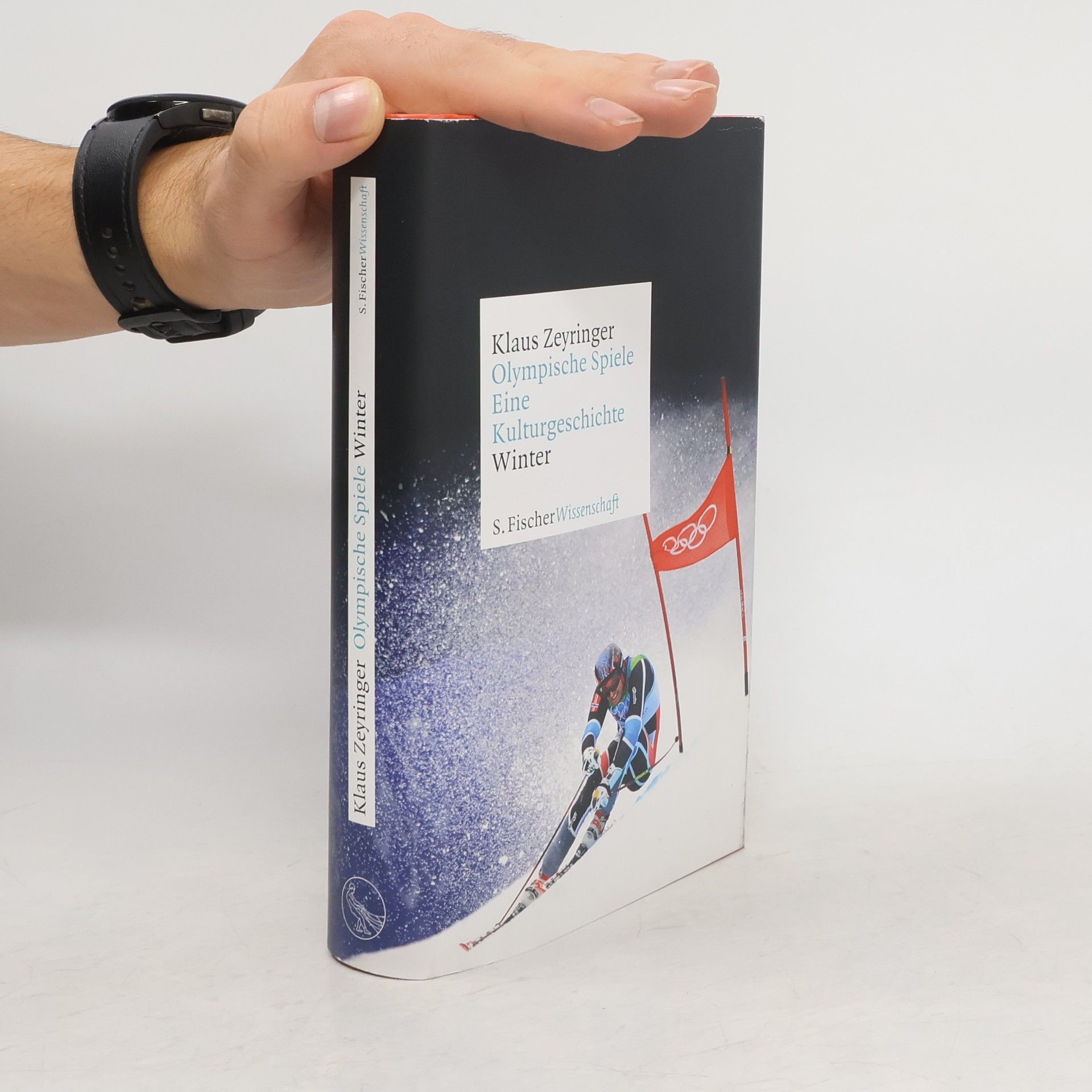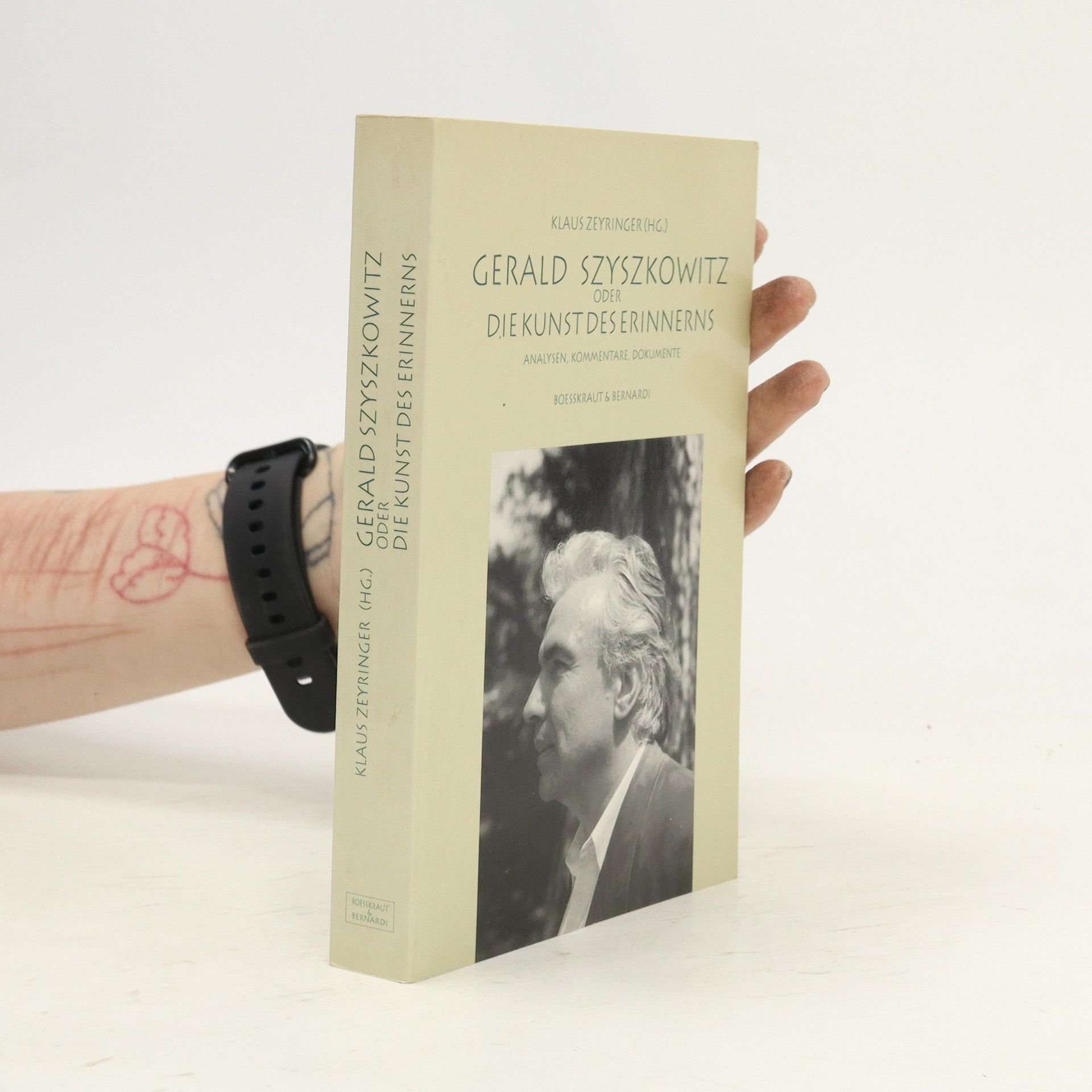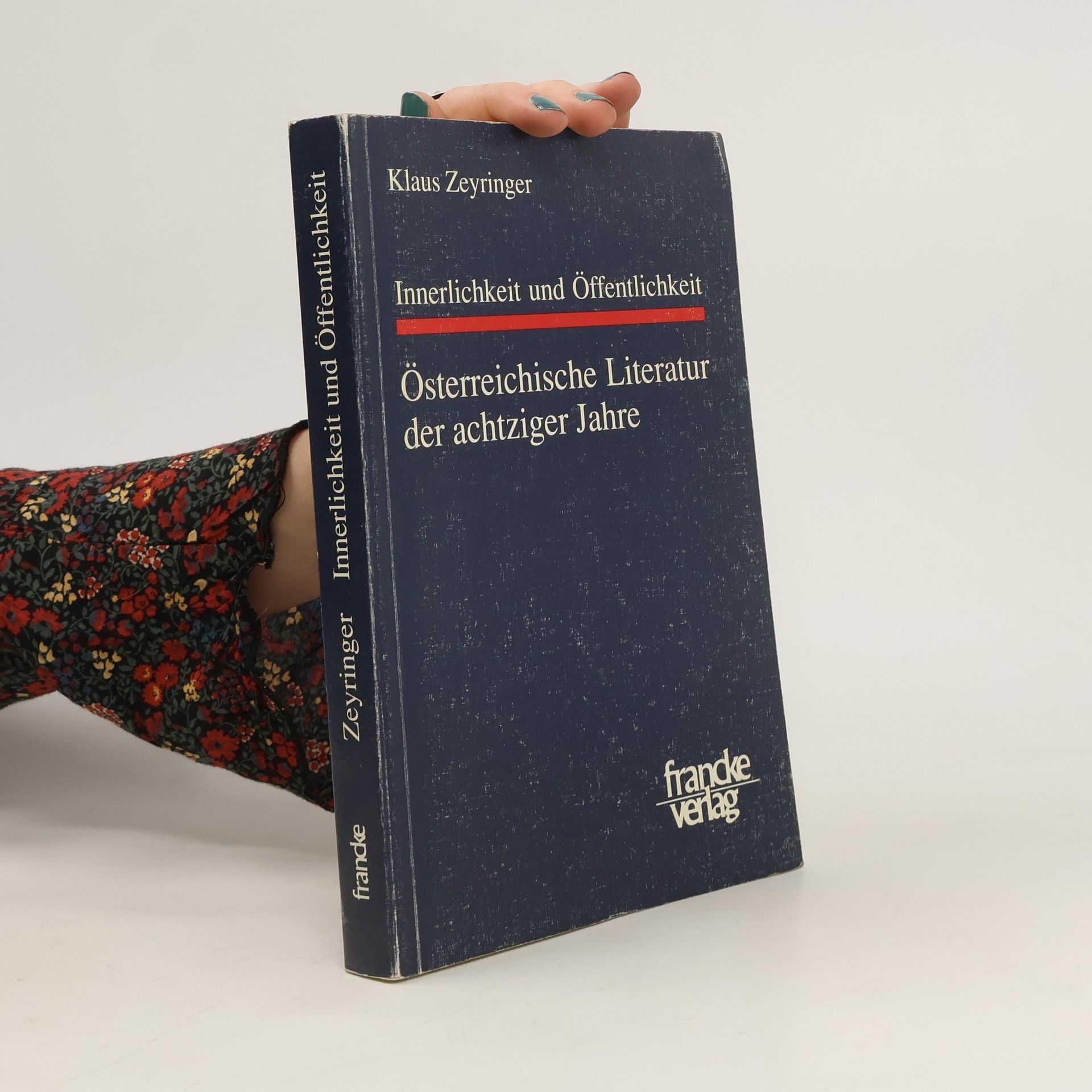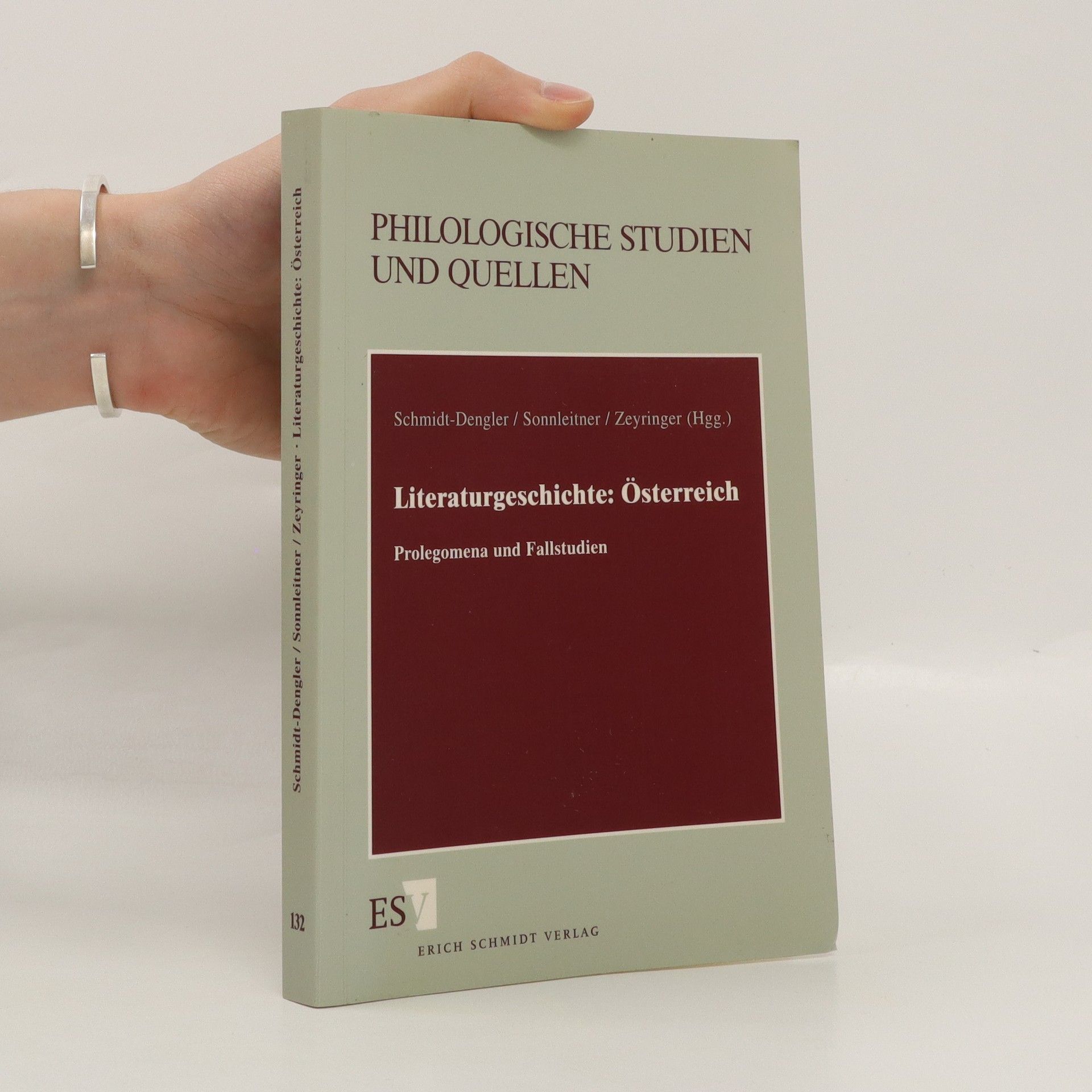Fußball
- 448 stránek
- 16 hodin čtení
Fußball ist mehr als ein Sport Fußball hat seit jeher die Menschen beflügelt. Indem dieser Sport Stammtisch und Intellektuellendiskurs verbindet, war er immer mehr als die Jagd nach einem Lederball. Hier wird jetzt seine Geschichte als Kulturgeschichte erzählt. Von den Anfängen in der Aristokratie Englands bis zum weltweiten Massenphänomen, von seinen politischen und sozialen Effekten bis hin zu seinen Spuren in der Alltagskultur, von Deutschland über Afrika bis nach Japan, Lateinamerika und den USA, von Mitte des 19. Jahrhunderts über die Zeiten der Diktaturen bis zur Globalisierung. Klaus Zeyringer rückt die schönste Nebensache der Welt ins glänzende Licht: witzig, informiert, überraschend und sehr unterhaltsam. »Ich kann nicht Fußball spielen, und ich interessierte mich auch nicht für Fußball. Naturgemäß wollte ich daher auch nie etwas über Fußball erfahren - bis mir dieses Buch in die Hände fiel. Etwas Interessanteres zum Thema kann ich mir nicht vorstellen. Lesen Sie das. Im Ernst: Lesen Sie das!« Daniel Kehlma nn