A critical overview of the previously under-examined aspect of walking as a practice in contemporary artistic production This catalog features around 100 photographs, videos, collages, drawings, paintings, sculptures and performances from over 40 artists in whose work walking represents an important element. Artists include David Hammons, Mona Hatoum, Kimsooja, Helen Mirra, Pope.L, Hans Schabus and more.
David le Breton Knihy
Francouzský antropolog a sociolog, profesor na Štrasburské univerzitě, zkoumá reprezentace a využití lidského těla. Jeho práce se zaměřuje na rizikové chování a jeho analýzu. Jeho díla jsou ceněna pro hloubku vhledu do společenských jevů.
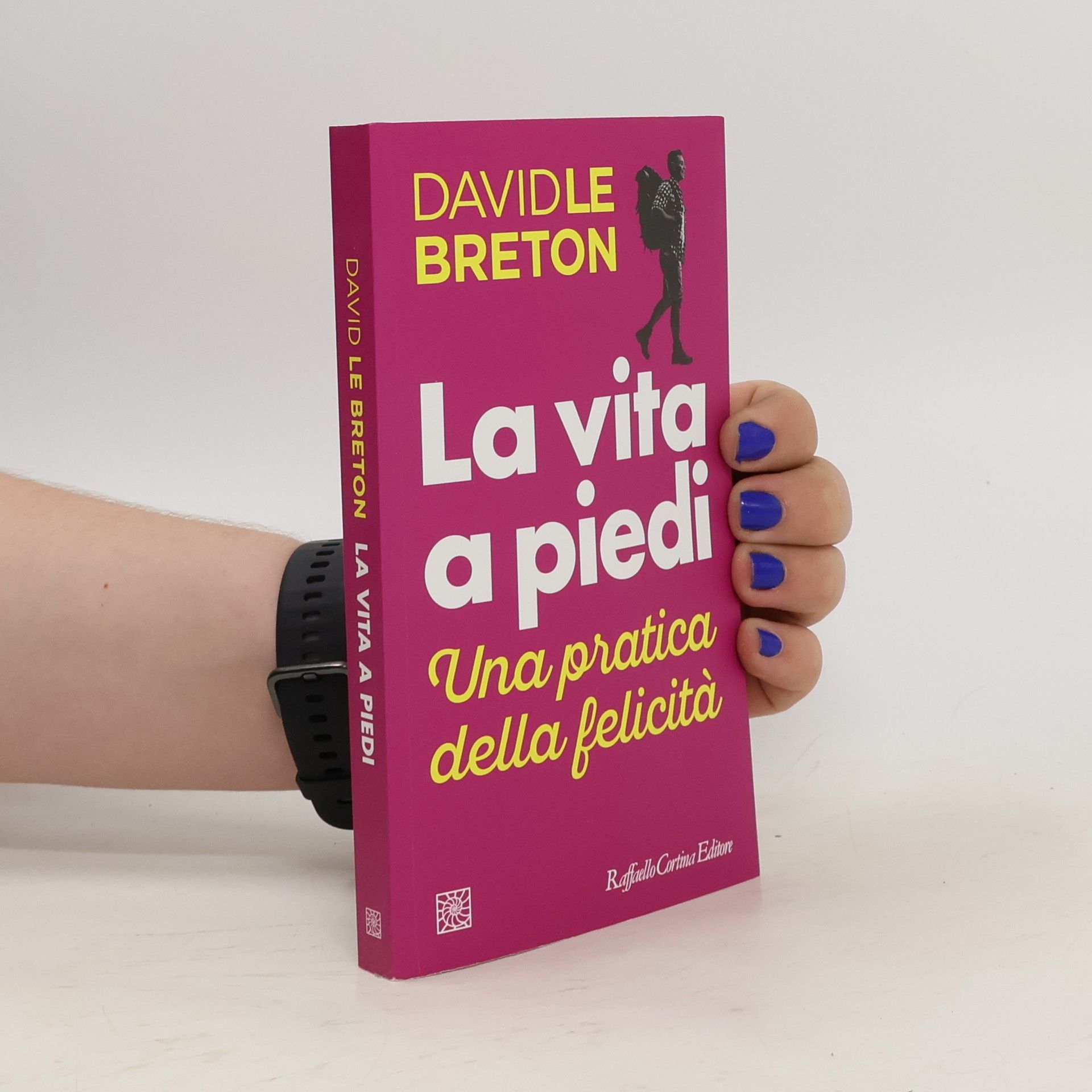
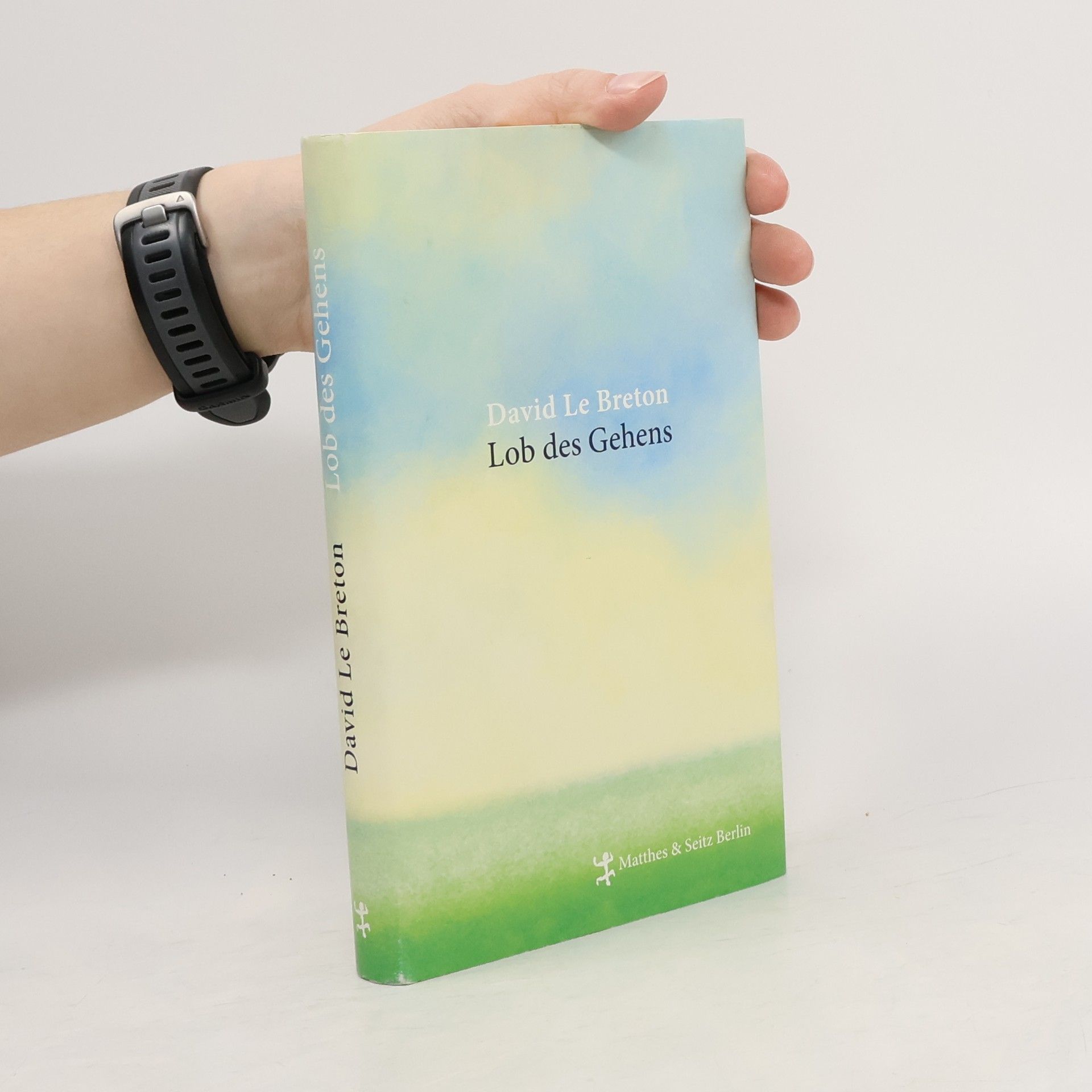
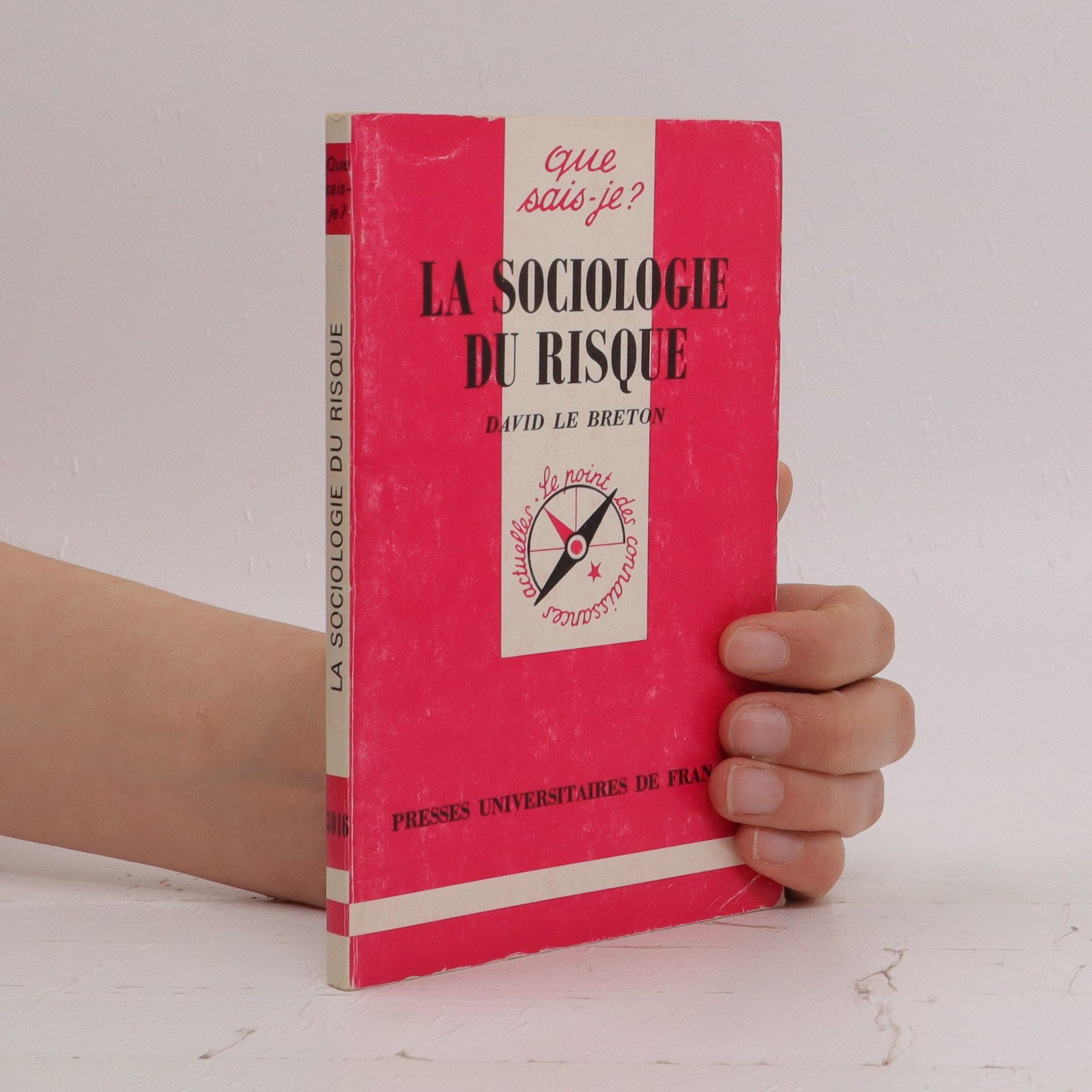



Toute existence est une permanente prise de risque elle expose à une fragilité physique (maladie, accident, etc.) ou symbolique (perdre la face, perdre son identité, l'estime de soi, etc.). Mais nos sociétés technologiques semblent générer de nouveaux risques collectifs, et des inquiétudes grandissantes parmi les populations. De ce constat est née dans les années 1980 une sociologie du risque portant des regards novateurs sur des zones de fractures de confiance et de fragilité.Une autre approche sociologique est venue enrichir l'analyse de la notion de risque en s'intéressant aux conduites à risques individuelles, aux significations que revêtent les activités engagées par les individus dans leur vie personnelle ou professionnelle, leurs loisirs, pour aller à la rencontre du risque ou s'en protéger.En s appuyant sur l analyse de nombreux exemples concrets, cet ouvrage dresse un panorama des recherches menées et des savoirs constitués ces dernières années autour de la notion de risque qui est désormais une question sociale, politique, économique, juridique, éthique, etc.
Das Gehen ist öffnung zur welt. Es versetzt den Menschen wieder in das glückliche empfinden seiner Existenz, beginnt David le Breton sein Essay über das gehen als Lebensform, und genau dieses glückliche empfinden seine Existenz stellt sich die beim leser auch bei der Lektüre des Buch ein. Le Breton erfasst mit einer Fülle an literarischen Gewährsleuten von Henry David Thoreau über Nietzsche und Nicos Kazantzakis, die unterschiedlichen Aspekte des Gehens und geht ihm auf dem Grund: gehen bedeutet Konfrontation des körpers mit der welt, gehen ist eine Philosophie der Existenz, jedes gehen wirft den Gehenden auf sich, und die eigene identität auf den eigenen platz in der Welt zurück. Le Breton vielstimmiger Essay ist eine fulminante, glänzend geschrieben Studie des menschlichen Antriebs, des Fortschreitens und vorankommen. David Le Breton erteit mit diesem Buch eine lektion des glücks Le Monde
Sebbene le nostre società sembrino privilegiare l'esercizio sportivo in luoghi chiusi, la pratica del camminare ha raggiunto un successo planetario. Per un camminatore, questa passione incarna significati multipli: la voglia di spezzare uno stile di vita routinario, di riempire le ore di scoperte, di sospendere le seccature quotidiane. Intraprendere un cammino risponde a un desiderio di rinnovamento, di avventura, di incontro e sollecita sempre tre dimensioni del tempo: prima lo si sogna, poi lo si fa, infine lo si ricorda e lo si racconta. Anche dopo averlo percorso, un cammino si prolunga nella memoria e nelle narrazioni che di esso si offrono, vive in noi e viene condiviso con gli altri. In questo libro intelligente e stimolante, l'autore svela il piacere e il significato del camminare, esaltandone le virtù terapeutiche per contrastare la fatica di vivere in un mondo sempre più tecnologico.