Praxis der tänzerischen Bewegung
- 134 stránek
- 5 hodin čtení


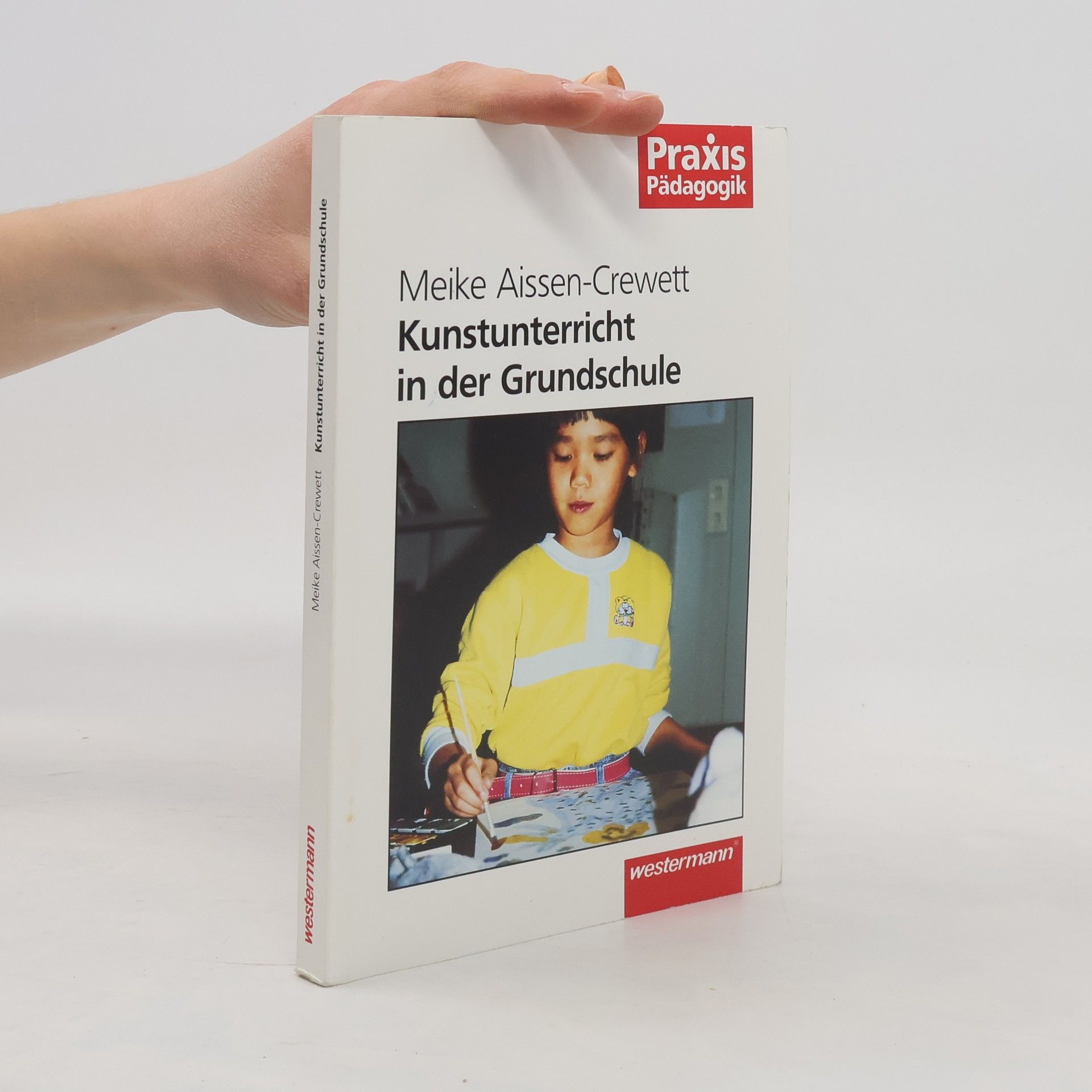
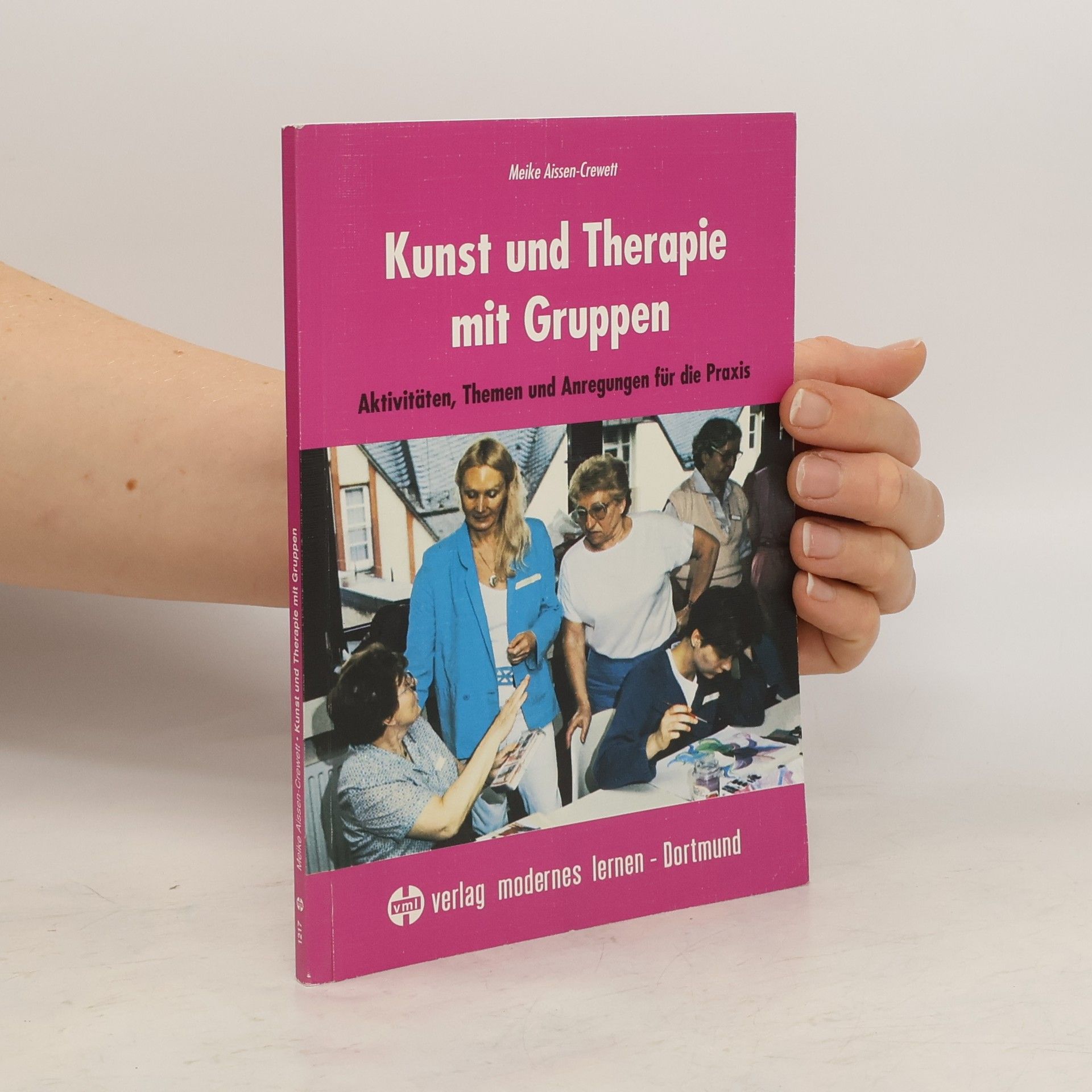

In diesem Buch wird dargelegt, warum Kunst (worunter alle bildnerischen, gestalterischen, ausdrucksbezogenen Aktivitäten zu verstehen sind) sich in besonderem Maße für die therapeutische Gruppenarbeit eignet. Hierzu werden vielfältige Anregungen, Hinweise, Vorschläge, Themen, Aktivitäten und Beispiele vorgestellt. Das Buch wendet sich an einen weiten Kreis: Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, Psychologen, Beschäftigungstherapeuten, Kunsttherapeuten, Kunst-, Sozial- und Sonderpädagogen und an alle, die Kunst in ihrer therapeutisch orientierten Arbeit mit Gruppen einsetzen wollen.
Dramatherapie, in den USA und Großbritannien eine geläufige Therapieform, bedarf in Deutschland noch immer der Durchsetzung. Die vorliegende Darstellung unternimmt den Versuch einer Grundlegung der Dramatherapie, einhergehend mit der Erörterung ihrer Grundbegriffe. Diskutiert werden u. a.: Interdisziplinäre Quellen der Dramatherapie in Gestalt des Spiels, der Spieltherapie, des Rituals, der Magie, des Schamanismus; unterschiedliche Ansätze der Psychotherapie (Jung, Freud, Reich, Laing, Rogers, Perls, Moreno, Satir) im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Dramatherapie; entwicklungspsychologische Fragen, insbesondere die Entwicklung der symbolbildenden Fähigkeit (Winnicott, Piaget, Freud, Bruner, Gombrich); die soziologischen Rollentheorien Meads und Goffmans; für die Dramatherapie bedeutsame Schauspielkonzepte, insbesondere Stanislawskis Konzept der Einfühlung, Brechts Konzept der emotionalen Distanzierung, Artauds Theater der Grausamkeit, Grotowskis Armes Theater, Barbas Konzept der Darstellung als Akt der Selbstanalyse, das Konzept der unmittelbaren Konfrontation im Living Theatre sowie Brooks Theater der Einfachheit; zentrale Begriffe der Dramatherapie, vor allem: Ich, Rolle, Nachahmung, Identifikation, Projektion, Übertragung, Distanzierung, Katharsis, Spontaneität
Kunst, Psychotherapie, Psychiatrie, (Sozial-)Medizin, Pädagogik ; Zusammenfassungen von internationalen Zeitschriftenaufsätzen 1972 - 1984 nebst einem Lexikon der Fachbegriffe