Habbo Knoch Knihy
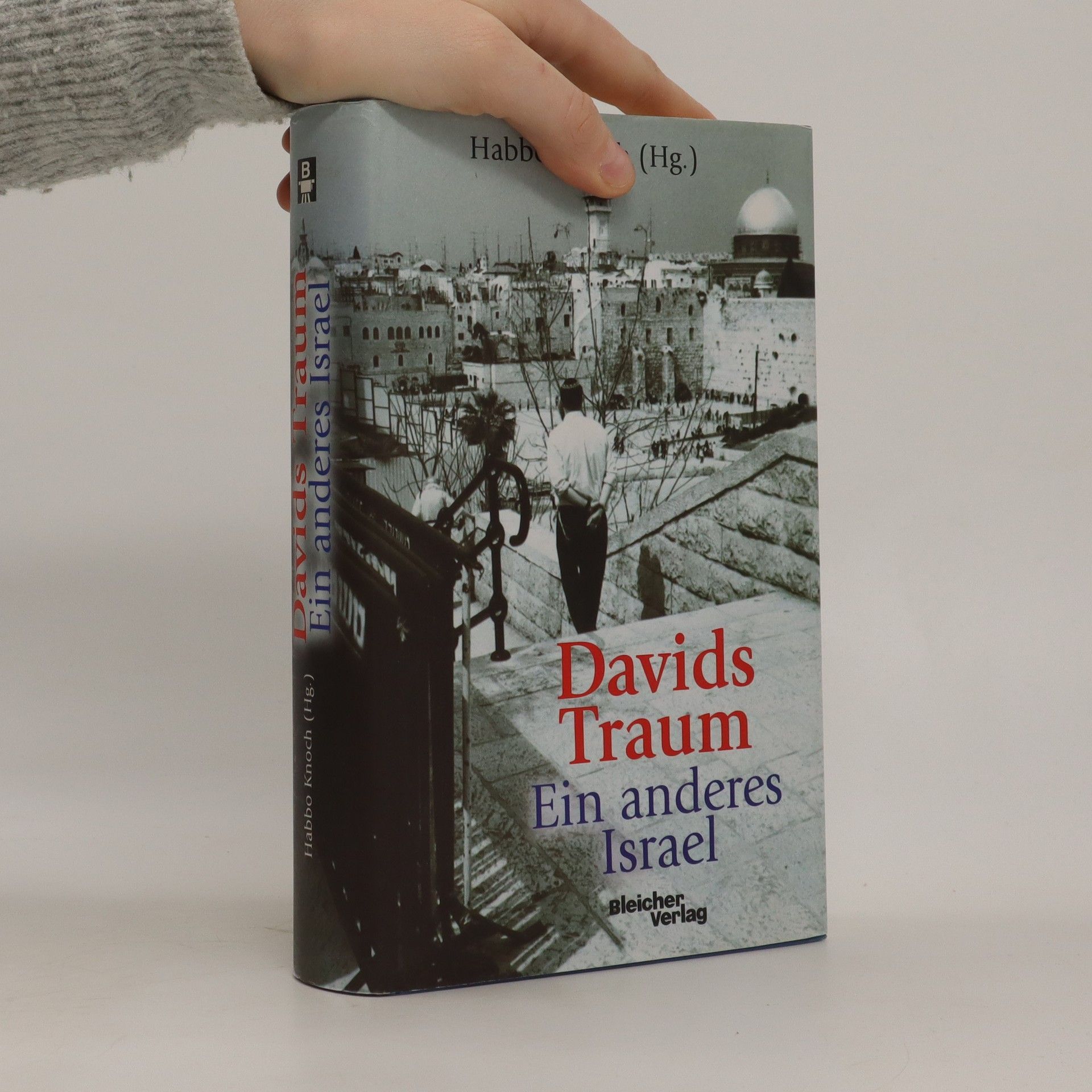

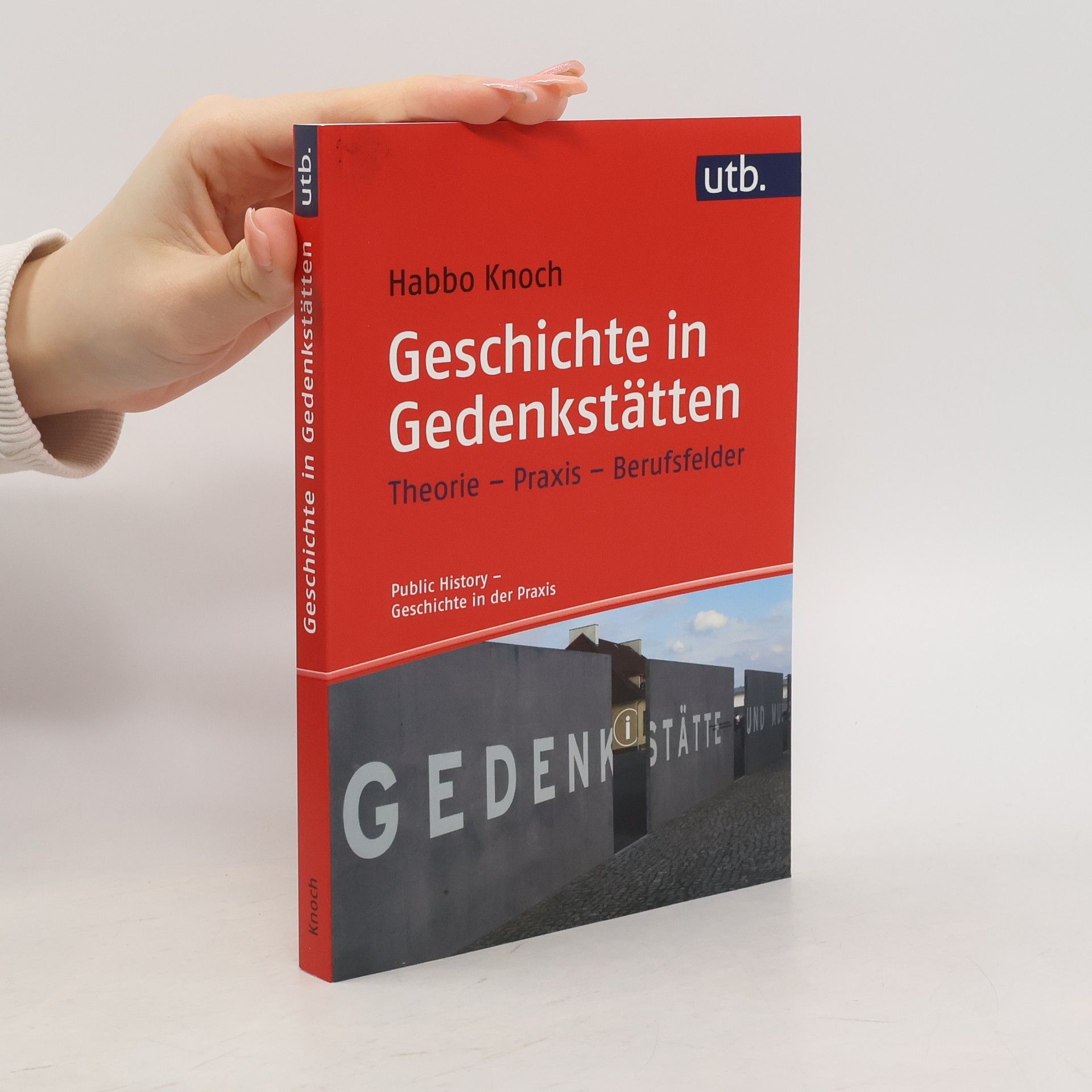

Geschichte in Gedenkstätten
Theorie – Praxis – Berufsfelder
Seit 1945 sind von Auschwitz bis Kigali weltweit eine Vielzahl von Gedenkstätten entstanden. Sie haben sich im Laufe der Geschichte als zentrale Orte der Erinnerung an das massenhafte Leiden von Menschen durch staatliche Verfolgung, Kriegsverbrechen und Völkermorde etabliert. An den historischen Tatorten erfüllen sie viele Aufgaben: Gedenken, Bewahren, Forschen, Vermitteln. Im Zentrum stehen die Erfahrungen der Opfer. Der Band zeichnet die Entwicklung und Geschichte von Gedenkstätten nach, führt in die wichtigsten Kontroversen ein und vermittelt einen Überblick zu den Aufgabenfeldern dieser Institutionen des kollektiven Gedächtnisses.
Im Namen der Würde
Eine deutsche Geschichte
Die Würde des Menschen ist unantastbar: nur ein Versprechen oder politische Maxime? Das Grundgesetz garantiert die Würde des Menschen – ein abstraktes Versprechen, aus dem im Laufe der Jahre sehr konkrete Forderungen abgeleitet wurden. Ging es der frühen Bundesrepublik um die Distanzierung von der nationalsozialistischen Diktatur, berief man sich später immer stärker auf die Menschenwürde, um gegen globale Ungerechtigkeit oder für die Rechte der Frauen zu kämpfen, sich für sexuelle Gleichberechtigung genauso einzusetzen wie gegen die Straffreiheit von Abtreibungen. Habbo Knoch erzählt, wie sich die Idee der unantastbaren Würde des Menschen schon vor 1945 entwickelte und wie sie, trotz aller unterschiedlichen Interpretationen, zur wichtigsten Übereinkunft der Deutschen wurde.
German