The black city
- 368 stránek
- 13 hodin čtení
The Black City is a portrait of New York City written by Hubert Fichte between 1978 and 1980. One of Germany's most important postwar authors, Fichte researched the city as the center of the African diaspora, conducting interviews and composing essays about syncretism in culture and the arts, material living conditions in the city, and political and individual struggles based on race, class, and sexuality. His interview partners include Michael Chisolm, arts educator and coordinator of the Black Emergency Cultural Coalition; German émigré and artist Lil Picard; photographer Richard Avedon; Léopold Joseph, publisher of the exile newspaper Haiti Observateur; and Teiji Ito, composer and Vodou initiate. The book opens with notes on an exhibition of Haitian art at the Brooklyn Museum, and closes with a self-reflective literary analysis of Herodotus, the first white European to write extensively of his travels and (desirous) encounters in Africa...Fichte's writing in The Black City provocatively exposes the complexities of its author's subjectivity in a manner that underscores the singularity of his writing, while prompting questions about how notions of exploitation, authority, and authenticity manifest themselves in pseudo-ethnographic practices. -- Publisher's description

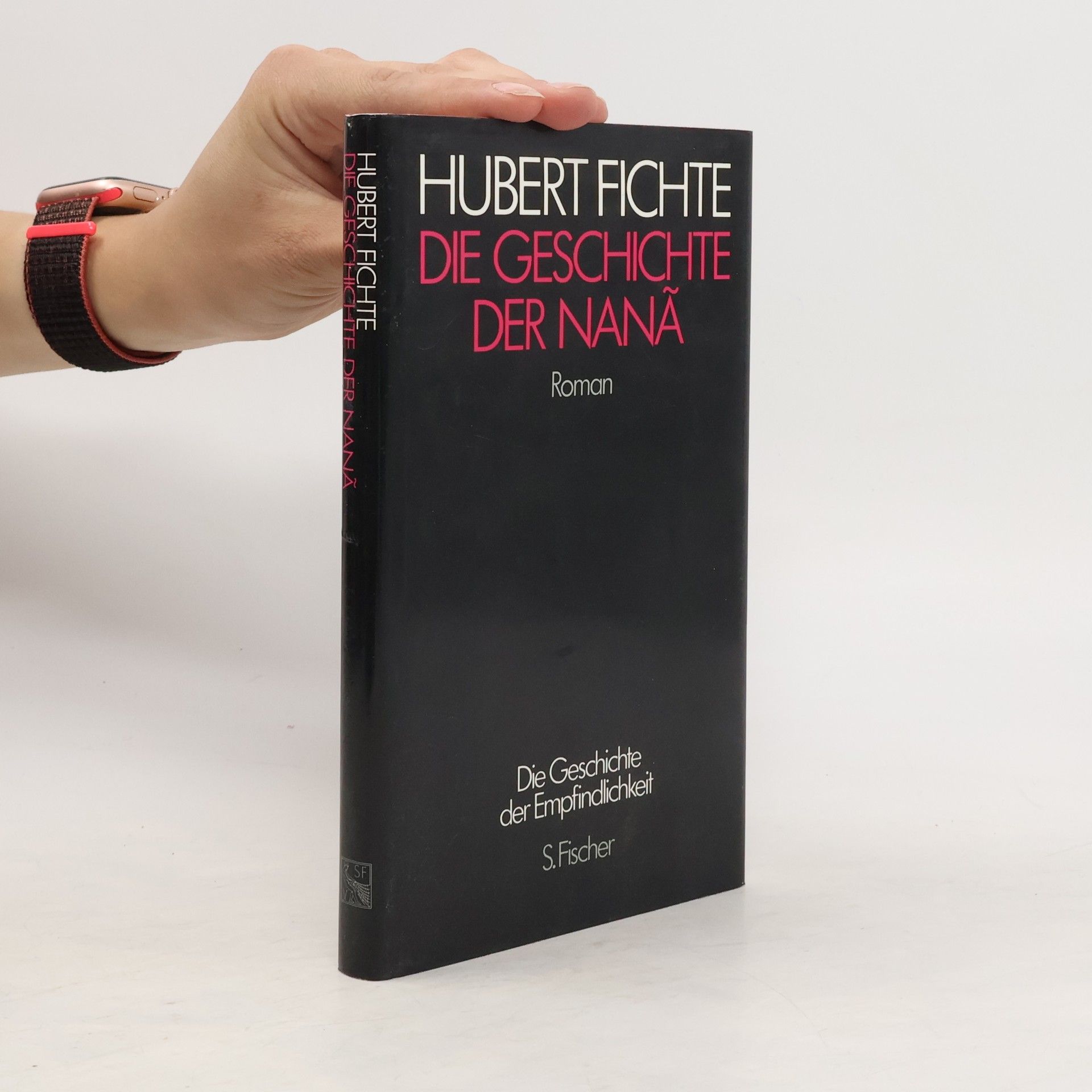

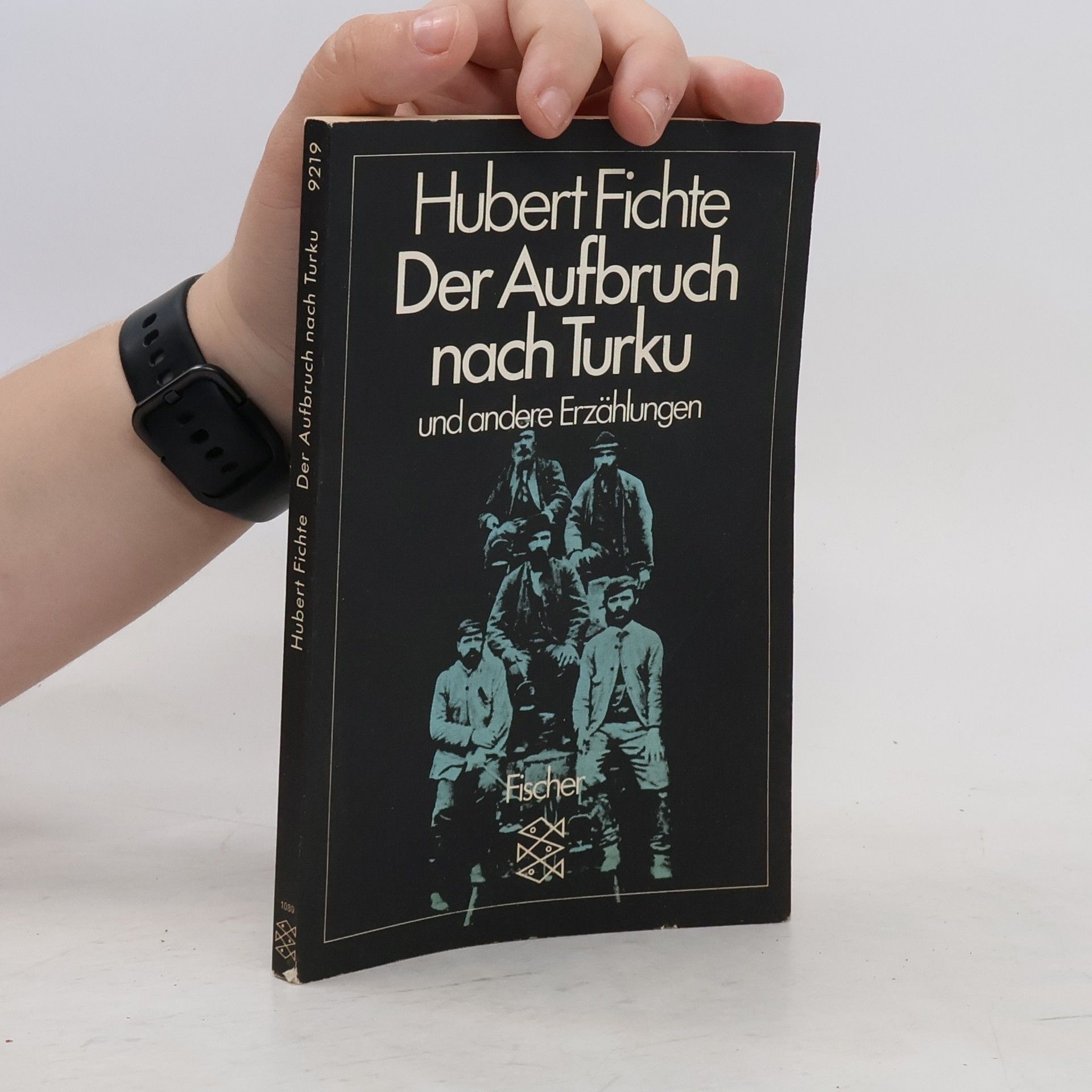
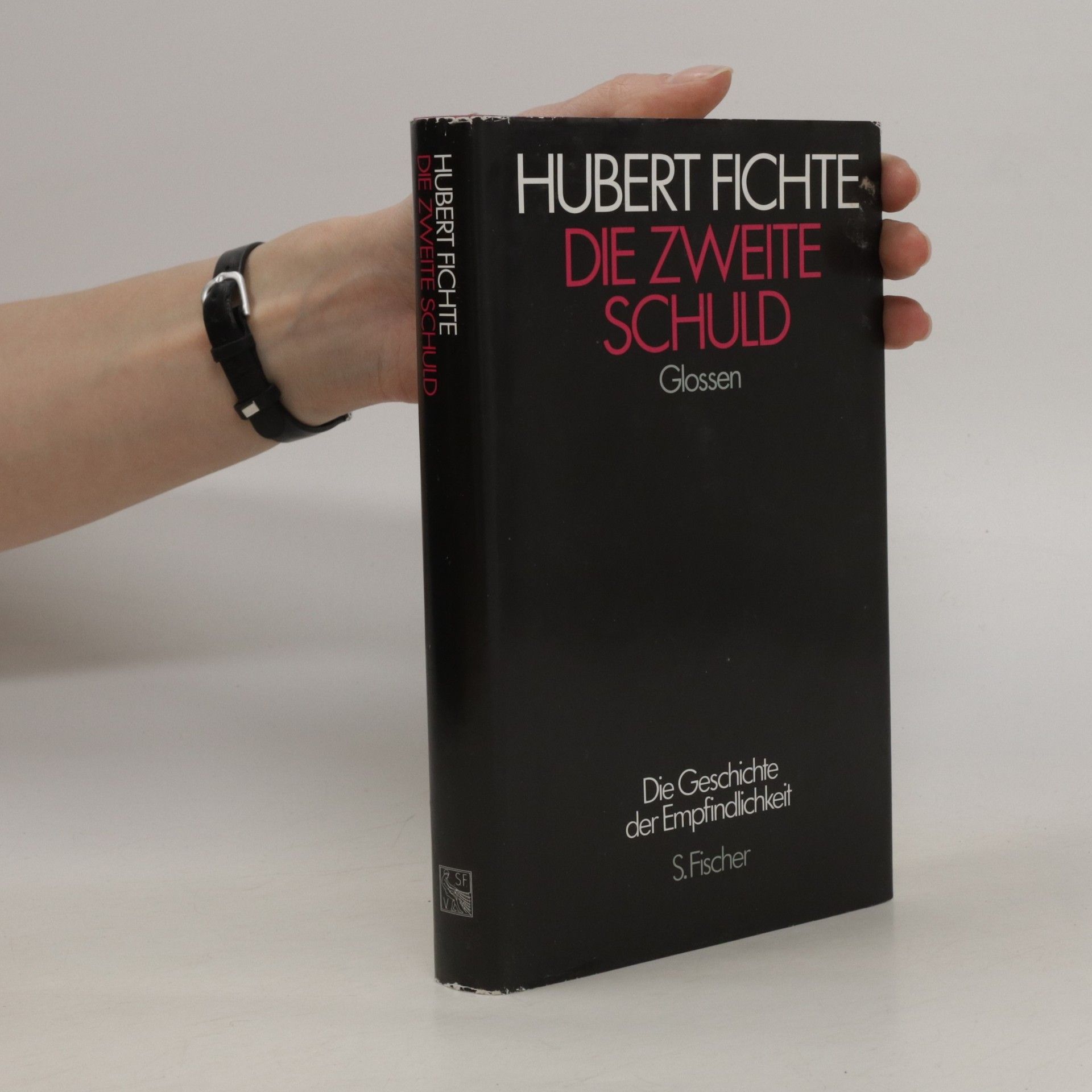

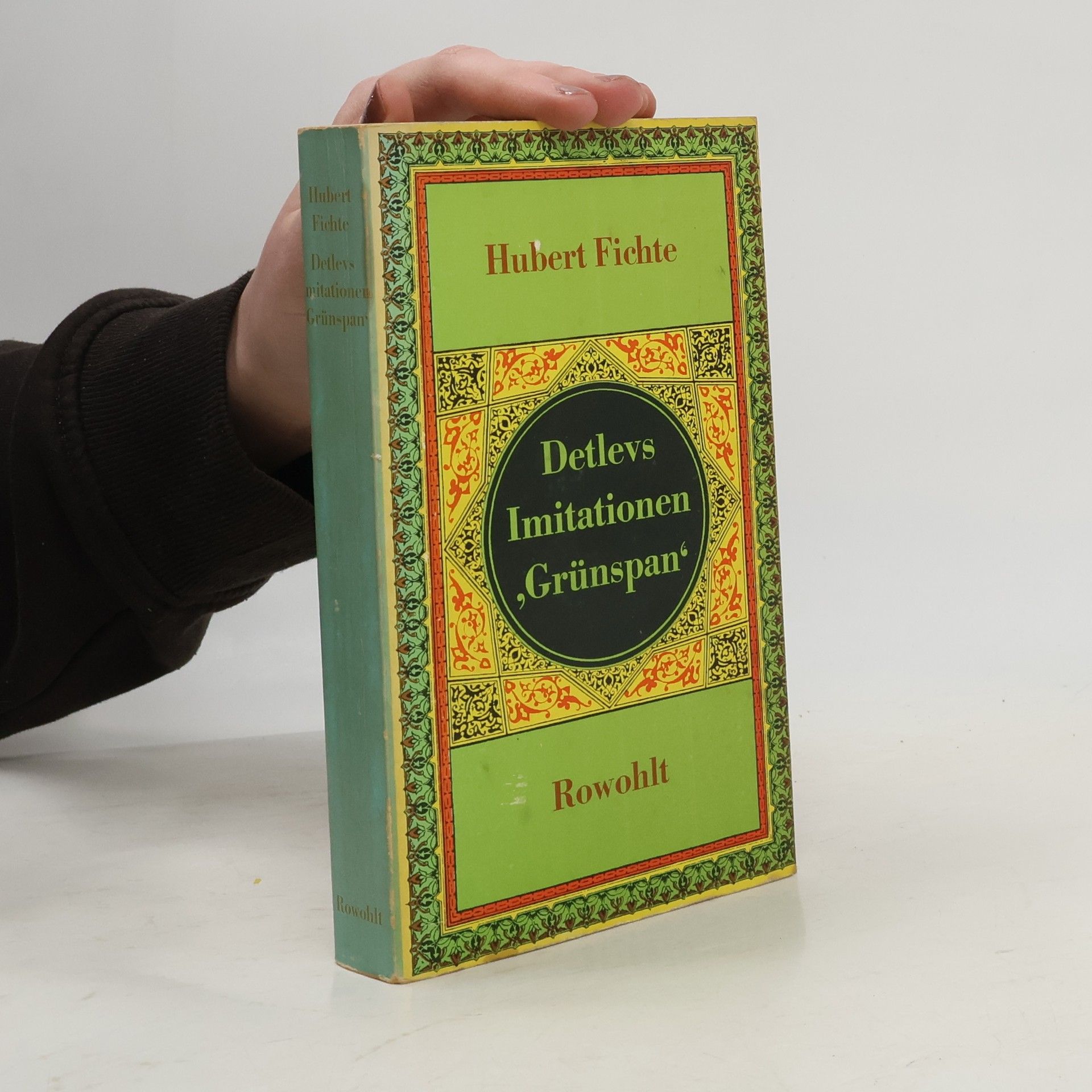

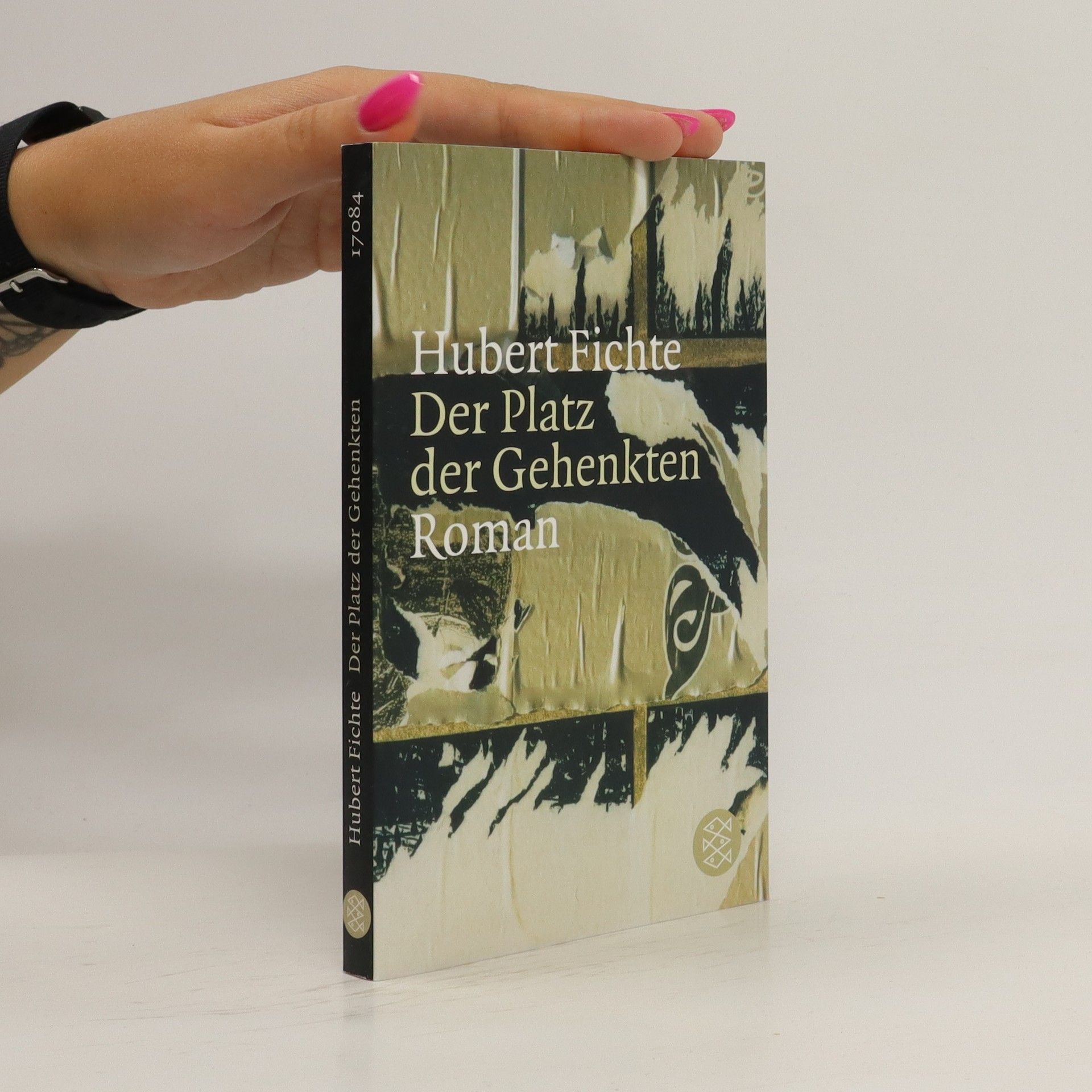
![Interviews aus dem Palais d' Amour etc. [et cetera]](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/49845159.jpg)