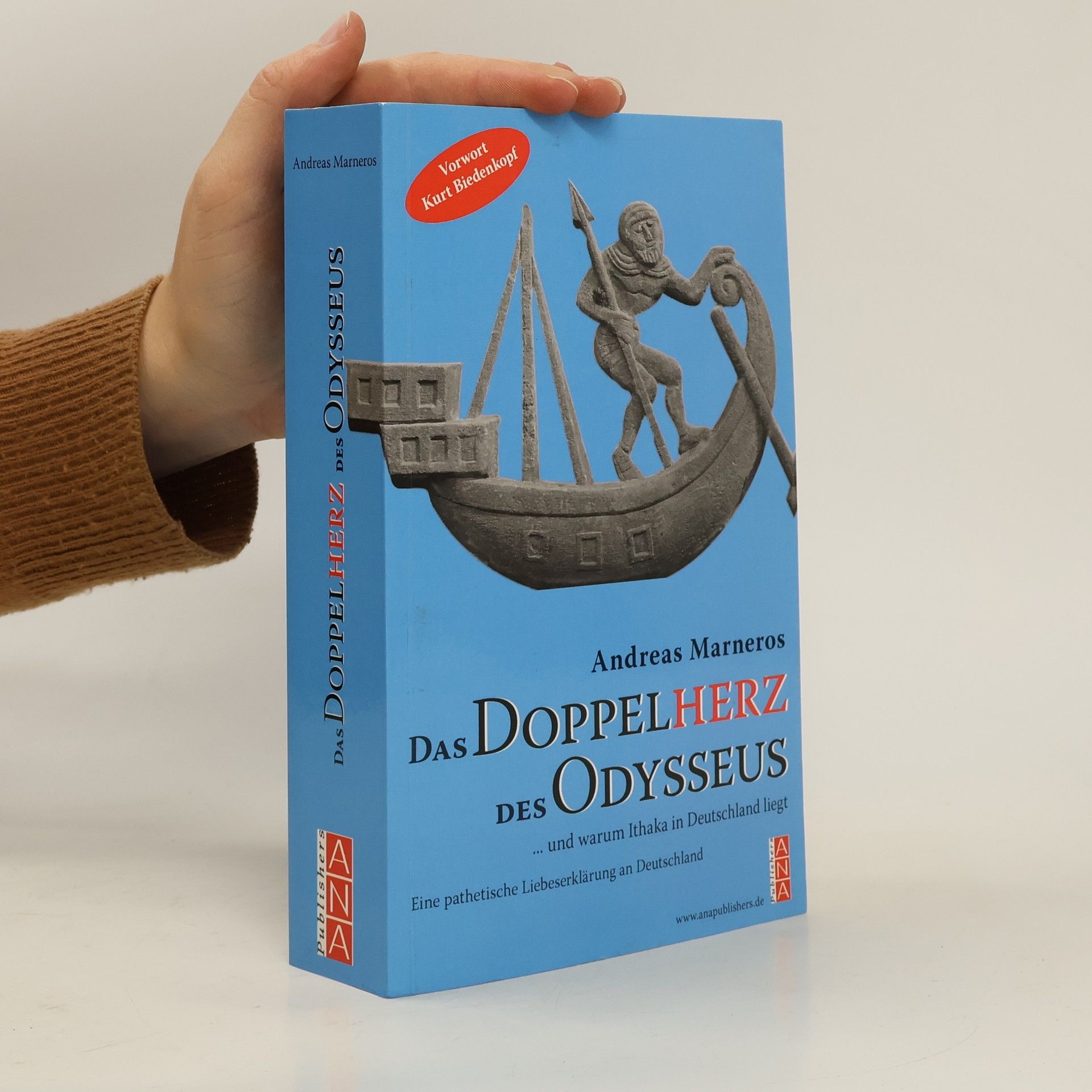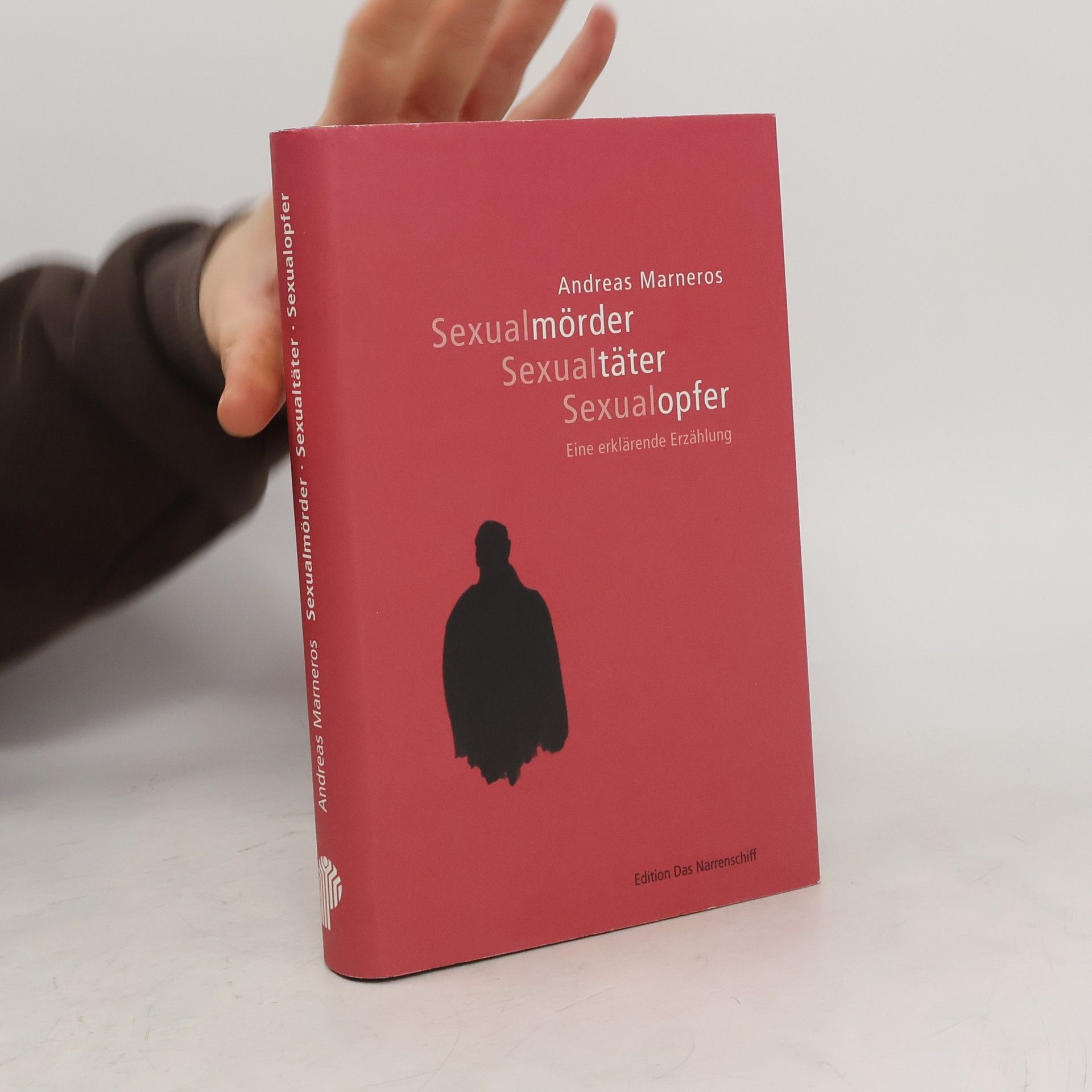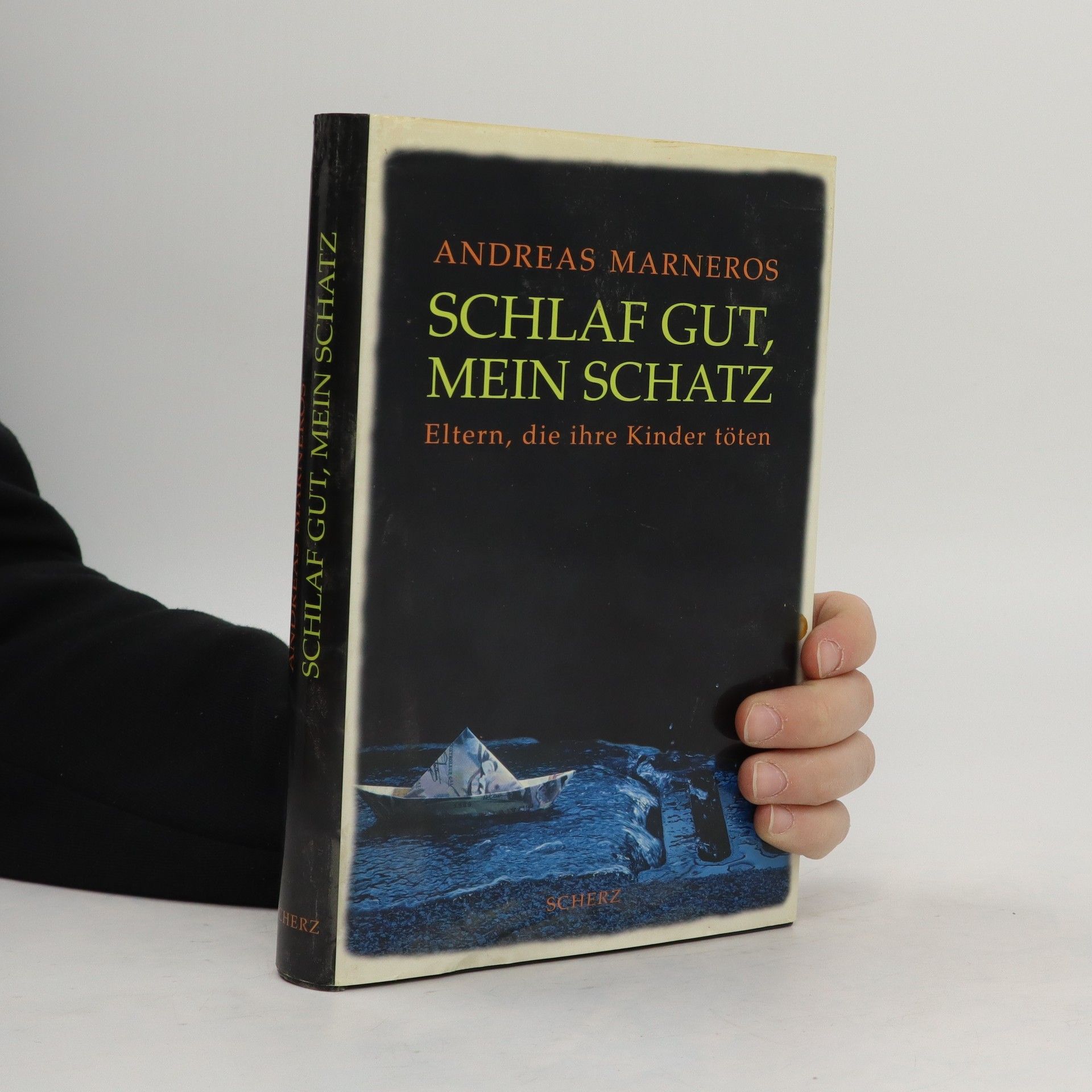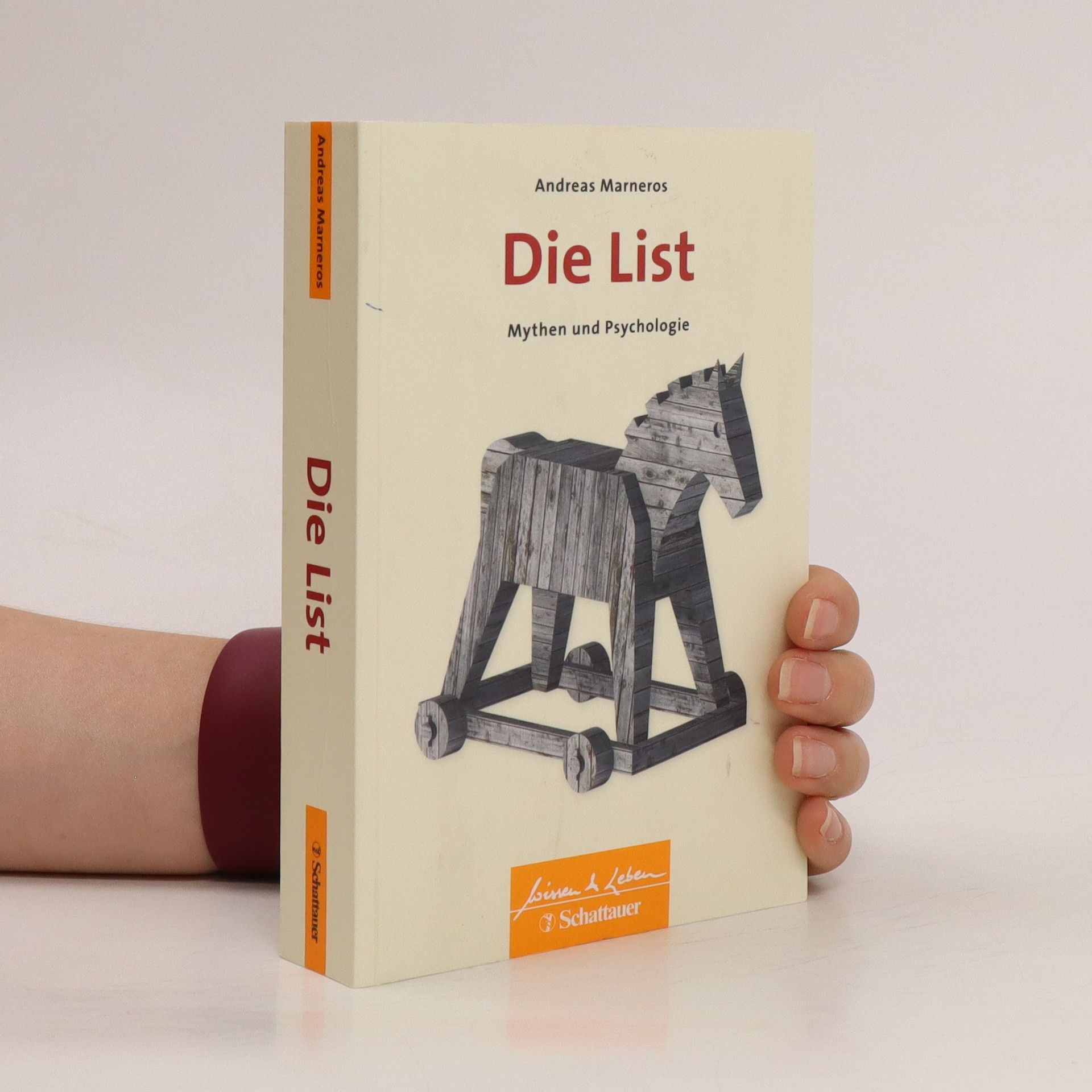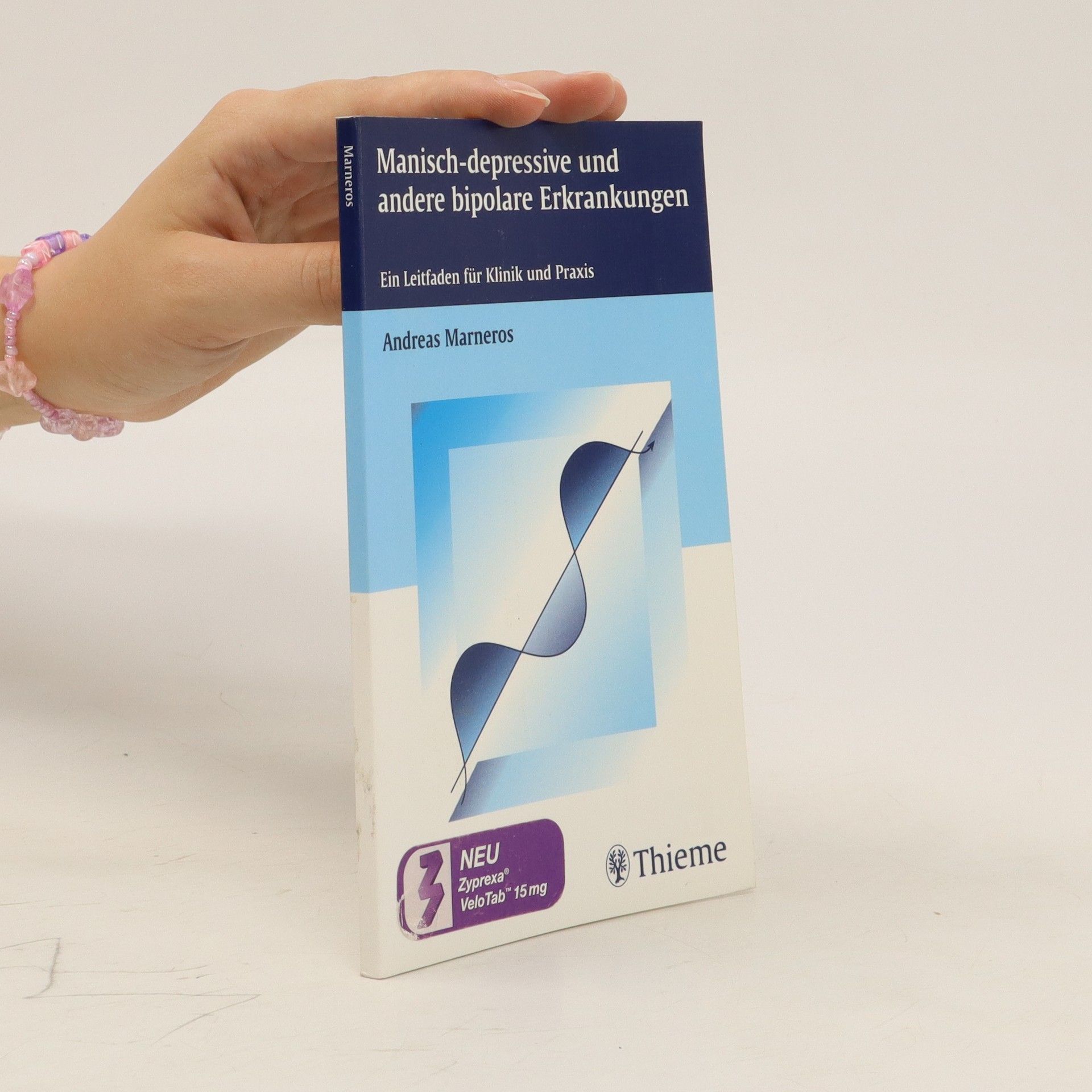Bitterer als der Tod ist die Frau
Die Angst des Mannes vor der Gleichberechtigung
Es soll die größte Revolution unserer Tage sein: die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Frau und Mann. Doch Krieg und Frieden zwischen den Geschlechtern begannen nicht erst mit dem Feminismus des 20. Jahrhunderts, sondern bereits mit ihrem Zusammenleben. Und natürlich stimmt es mitnichten, dass die Frau „bitterer als der Tod“ ist, wie es in der Bibel steht – was allerdings eine Haltung reflektiert, die erheblich zur Diskriminierung der Frauen beitrug. Der bekannte Psychiater und Autor Andreas Marneros geht auf unterhaltsame, spannende und sachkundige Weise der Entstehungsgeschichte und den psychologischen Mechanismen der Geschlechterbeziehungen, insbesondere der sogenannten „Misogynie“, nach. Dabei erzählt er von der Rolle, die Religion, Philosophie, Mythologie, Geschichte, Wissenschaft und Politik als Verursacher und Verstärker der Diskriminierung von Frauen spielen – eine Diskriminierung, die nicht in Hass, wie allgemein behauptet, sondern in der Angst vor den Frauen begründet ist. Marneros zeigt Wege auf, wie diese Angst der Männerwelt vor der Gleichberechtigung abgebaut werden kann. Sein Fazit lautet: Dazu reicht Gleichstellung allein nicht aus, eine flächendeckende und die Frauen respektierende, eine „gynäkophile“ Kultur ist dringend nötig. Eine Kultur allerdings, die auch den Mann respektiert.