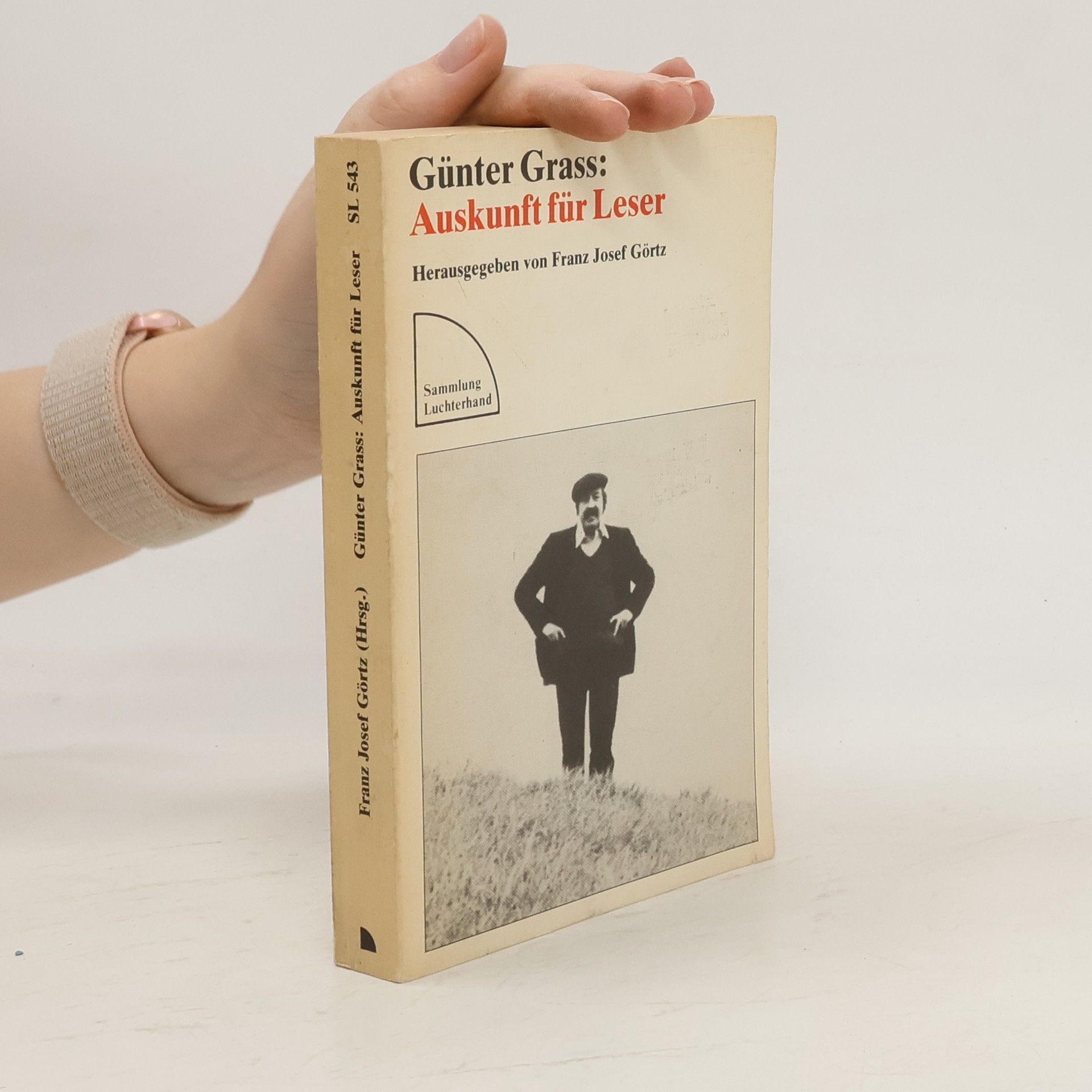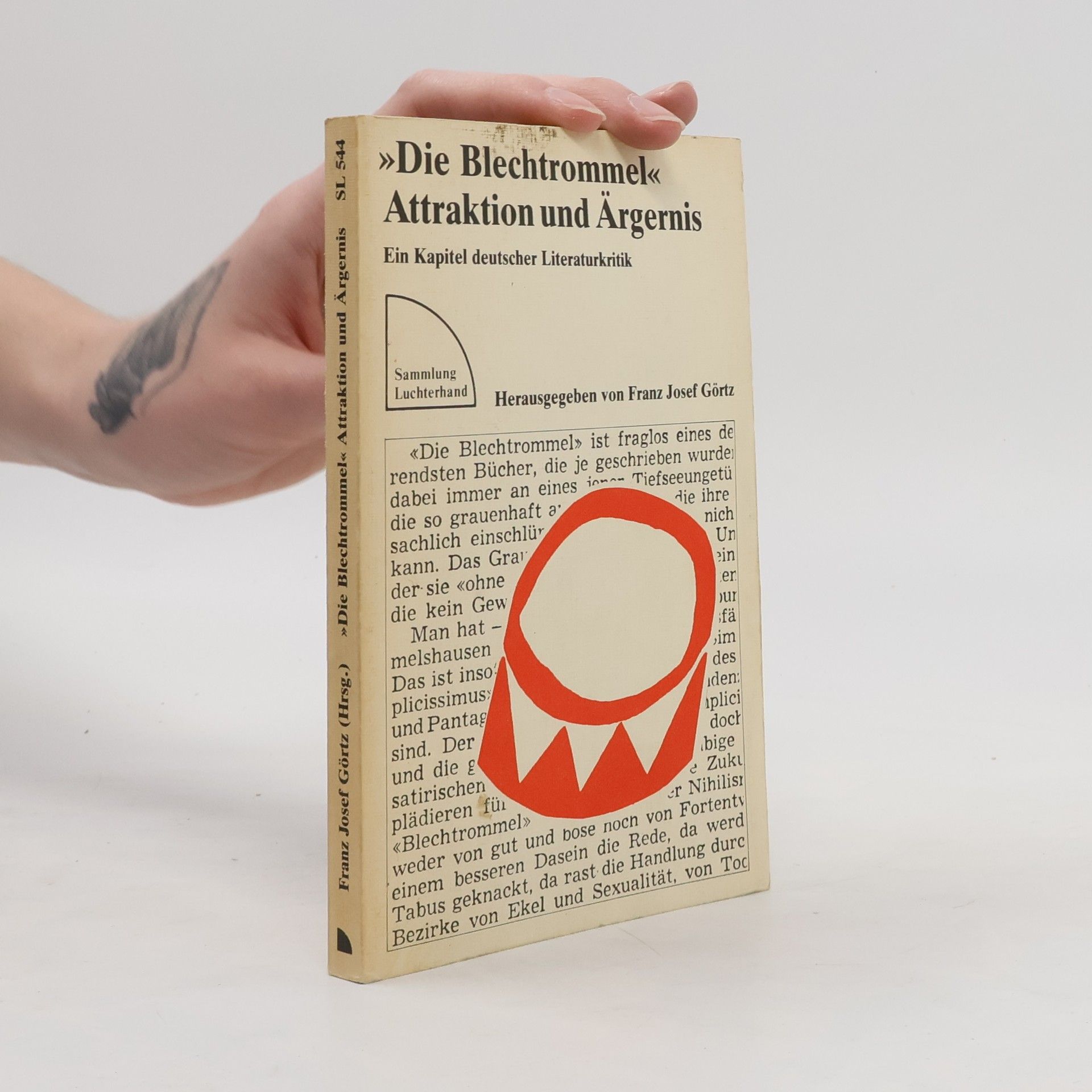"Fabelhaft! Aber falsch!"
- 141 stránek
- 5 hodin čtení
Marcel Reich-Ranicki im O-Ton: Das klang nie zimperlich, sondern war stets direkt, manchmal aggressiv und meist überaus witzig. Er brachte die Sache nicht bloß auf den Punkt, ihm fiel dazu spontan auch noch eine zündende Pointe ein. Er besaß zudem den behänden Wortwitz und die theatralische Omnipräsenz des genuinen Entertainers – und war deshalb eine Medienfigur nicht erst, seit das Literarische Quartett auf Sendung ging. Franz Josef Görtz war einer von Marcel Reich-Ranickis engsten Mitarbeitern. Für dieses Buch hat er die besten Bonmots und Anekdoten von Deutschlands Literaturpapst zusammengetragen. Marcel Reich-Ranicki wurde am 2. Juni 1920 in Polen geboren. 1940 kam er ins Warschauer Ghetto. Er war Literaturkritiker der ZEIT und leitete den Literaturteil der FAZ. Von 1988 bis 2001 war er Mitglied im 'Literarischen Quartett' des ZDF. Er wurde mit zahllosen Ehrungen und Preisen ausgezeichnet. Reich-Ranicki starb 2013 im Alter von 93 Jahren.