Der 27. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) fand vom 3. bis 7. April 1995 in Halle an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg unter dem Thema „Gesellschaften im Umbruch“ statt. Der DGS-Vorstand strebte einige Neuerungen an, darunter einen Call for Papers zur Auswahl der Referenten und eine „schlankere“ Struktur des Kongresses mit weniger Ad-hoc- und Plenarveranstaltungen. Im Vergleich zum letzten Kongress in Düsseldorf gab es statt 120 nur 80 Veranstaltungen und etwa 380 Referate statt knapp 600. Die Plenarthemen und Abendvorträge sind im Kongreßband I, herausgegeben von Lars Clausen, dokumentiert. Der Kongreßband II wurde neu konzipiert: Statt alle Vorträge aus den Sektionen, Arbeitsgruppen und Ad-hoc-Gruppen auf drei Seiten zu publizieren, wurden nur die Vorträge der Sektionen und Arbeitsgruppen aufgenommen, wobei jeder Gruppe dreißig Seiten zur Verfügung standen. Wenn einige Sektionen weniger Seiten belegt haben, liegt das daran, dass nicht alle Referenten ihre Beiträge eingereicht haben, nicht an einer Benachteiligung. Dadurch steht im Schnitt mehr Raum für jeden Beitrag zur Verfügung, was die Hoffnung weckt, die Qualität der Beiträge zu erhöhen und ihnen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen.
Heinz Sahner Knihy
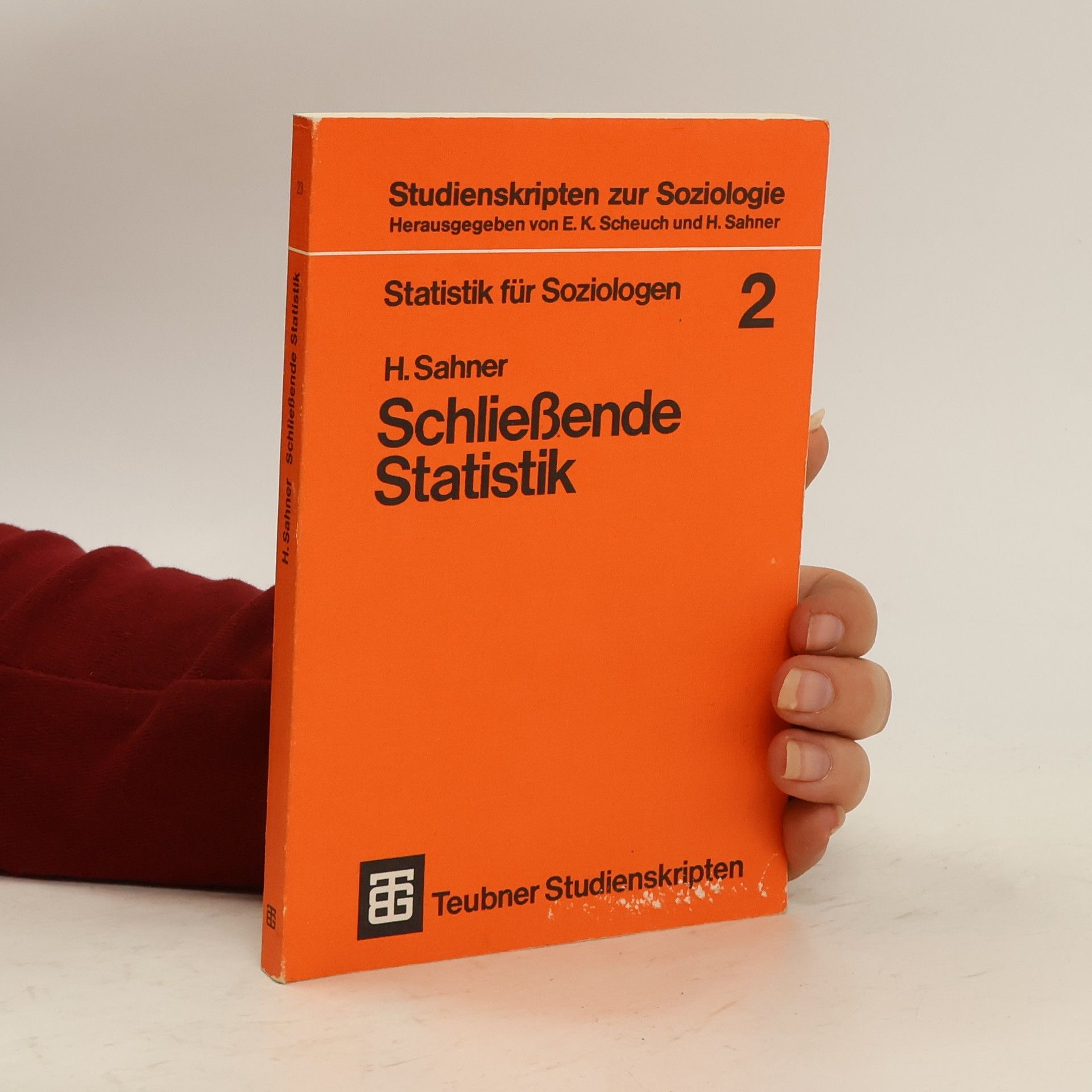
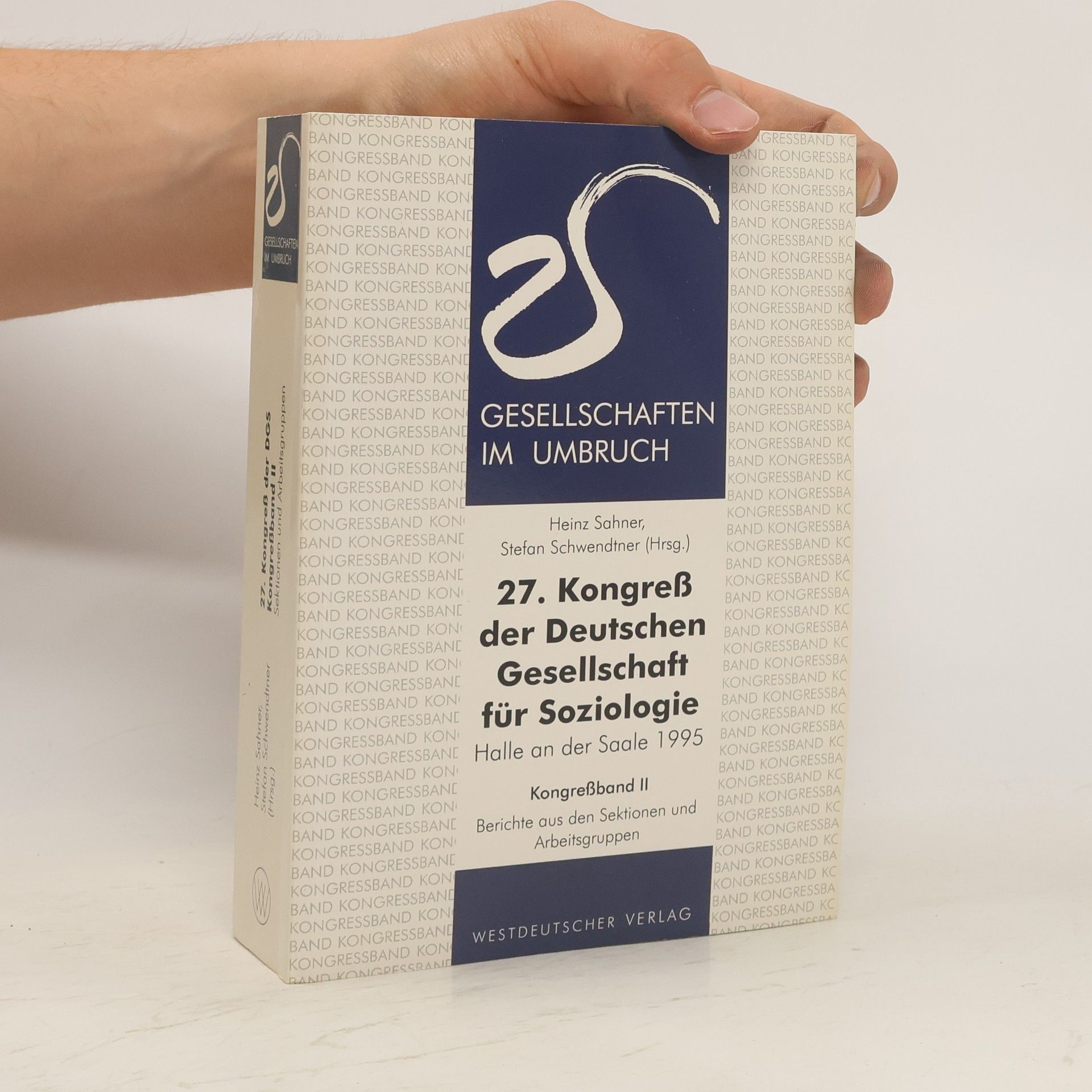
Statistik für Soziologen
- 188 stránek
- 7 hodin čtení