Das Buch gibt einen Überblick über die mehr als fünfhundertjährige Geschichte des Schreibens und Herstellens, des Verkaufs und der Lektüre von Büchern im deutschsprachigen Raum.
Reinhard Wittmann Knihy

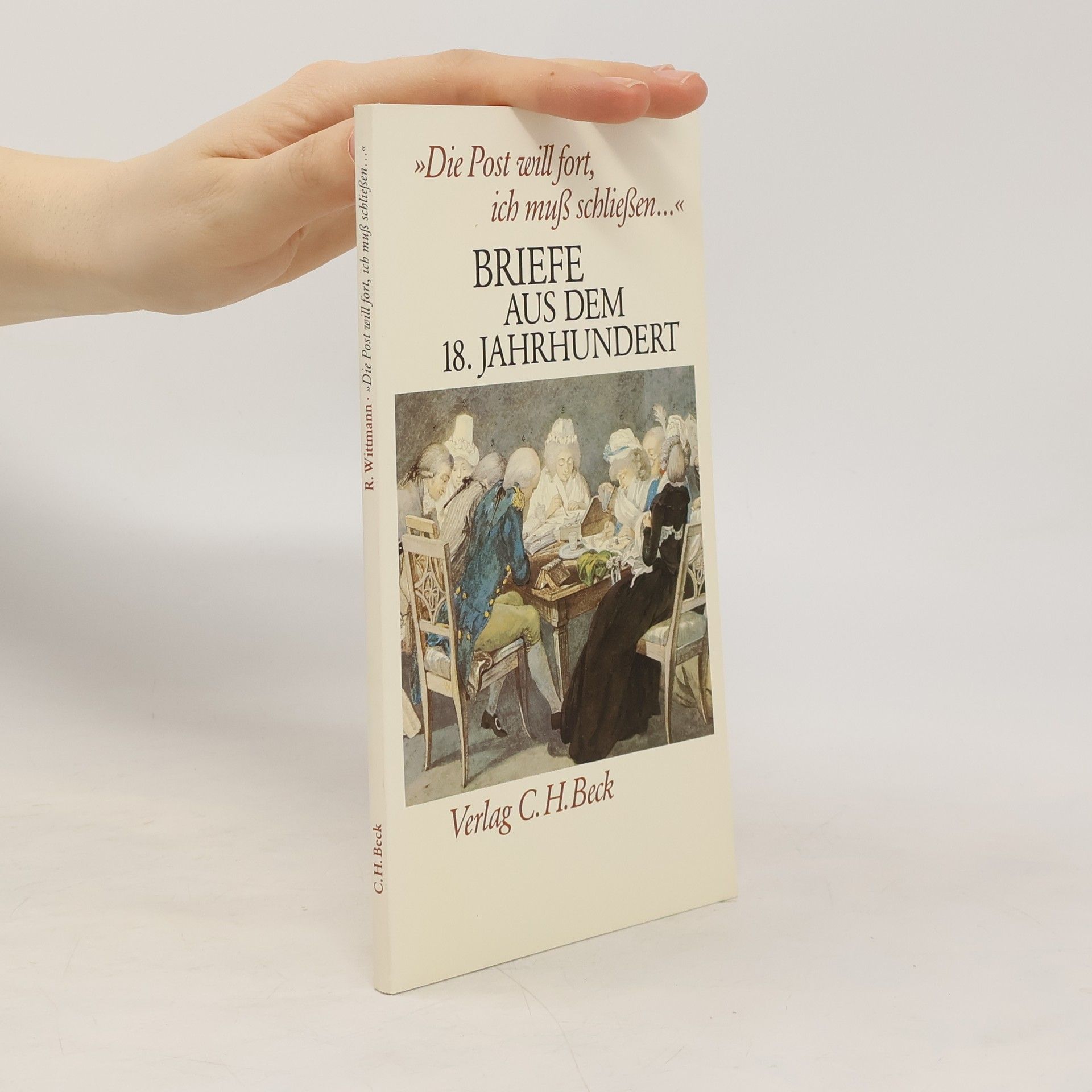

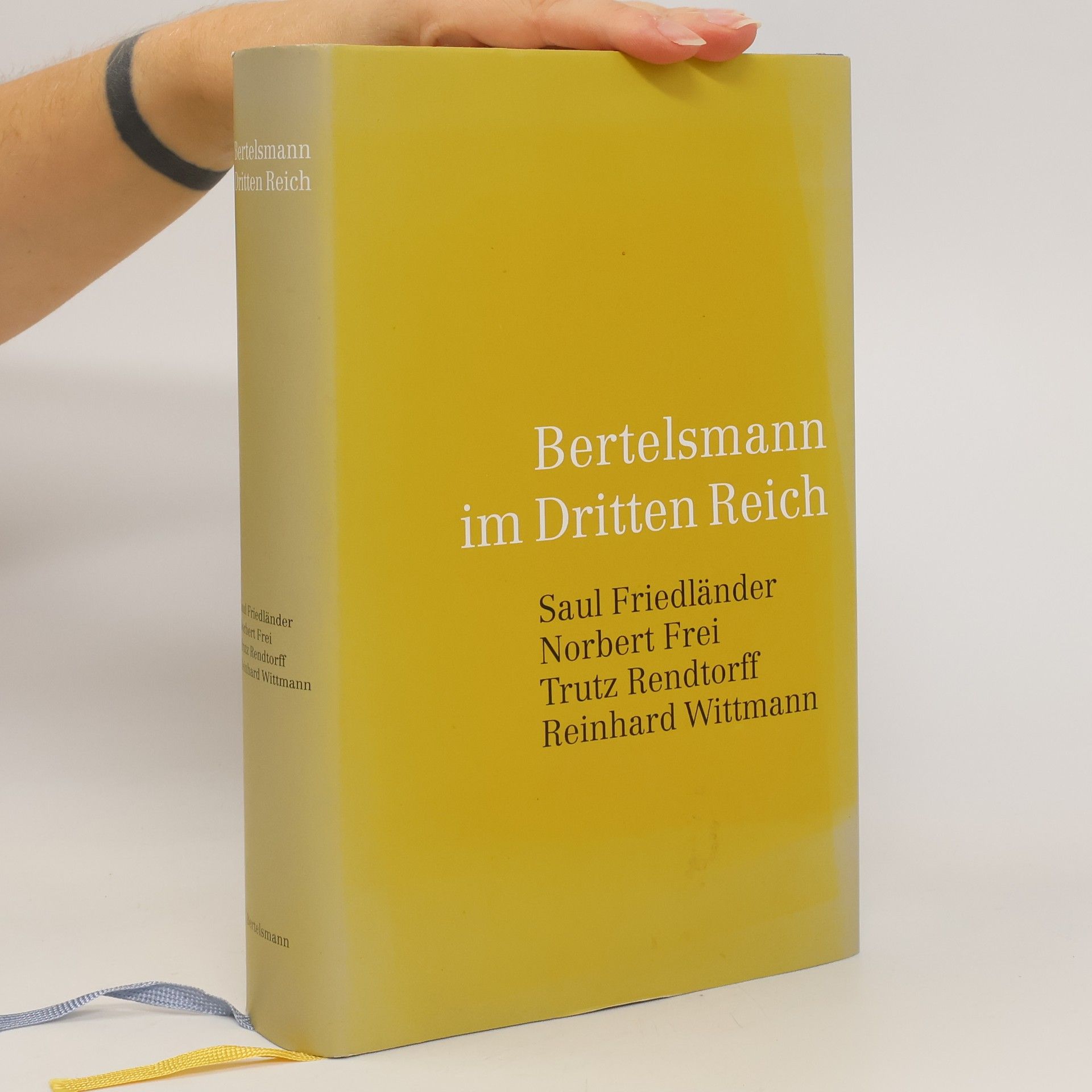

Bertelsmann im Dritten Reich
- 800 stránek
- 28 hodin čtení
An der Geschichte des Verlagshauses Bertelsmann im Dritten Reich entzündete sich im Herbst 1998 eine öffentliche Debatte. Zur Klärung der Vorwürfe berief die Bertelsmann AG eine »Unabhängige Historische Kommission zur Erforschung der Geschichte des Hauses Bertelsmann im Dritten Reich«. Das Buch dokumentiert die Ergebnisse der Kommission und gibt differenziert Aufschluss über das Selbstverständnis des Unternehmens, seine Anpassungsbereitschaft, seine ideologische Affinität zum NS-Regime wie auch über seinen ökonomischen Aktionswillen. Die Darstellung zeigt, wie komplex sich das Verhältnis von Marktrationalität und politischer Opportunität, von unternehmerischem Handlungsspielraum und weltanschaulichem Profil im konkreten Fall gestaltete.
Von Ladenhütern und Paukenschlägern
Beiträge zur deutschen Buchgeschichte 1600-1900
Betriebskunde für gastgewerbliche Berufsschulen
- 132 stránek
- 5 hodin čtení