Helmut Tervooren Knihy
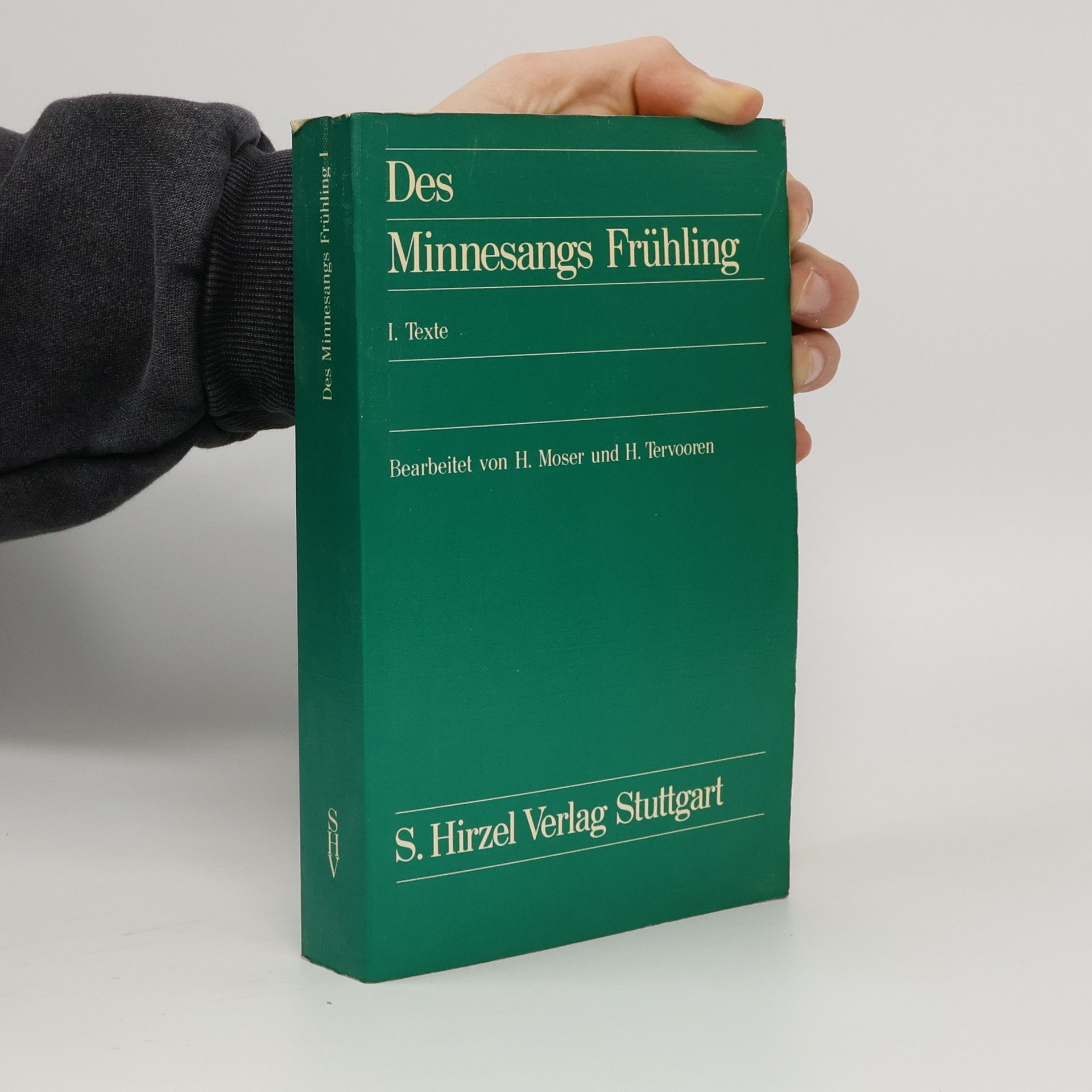
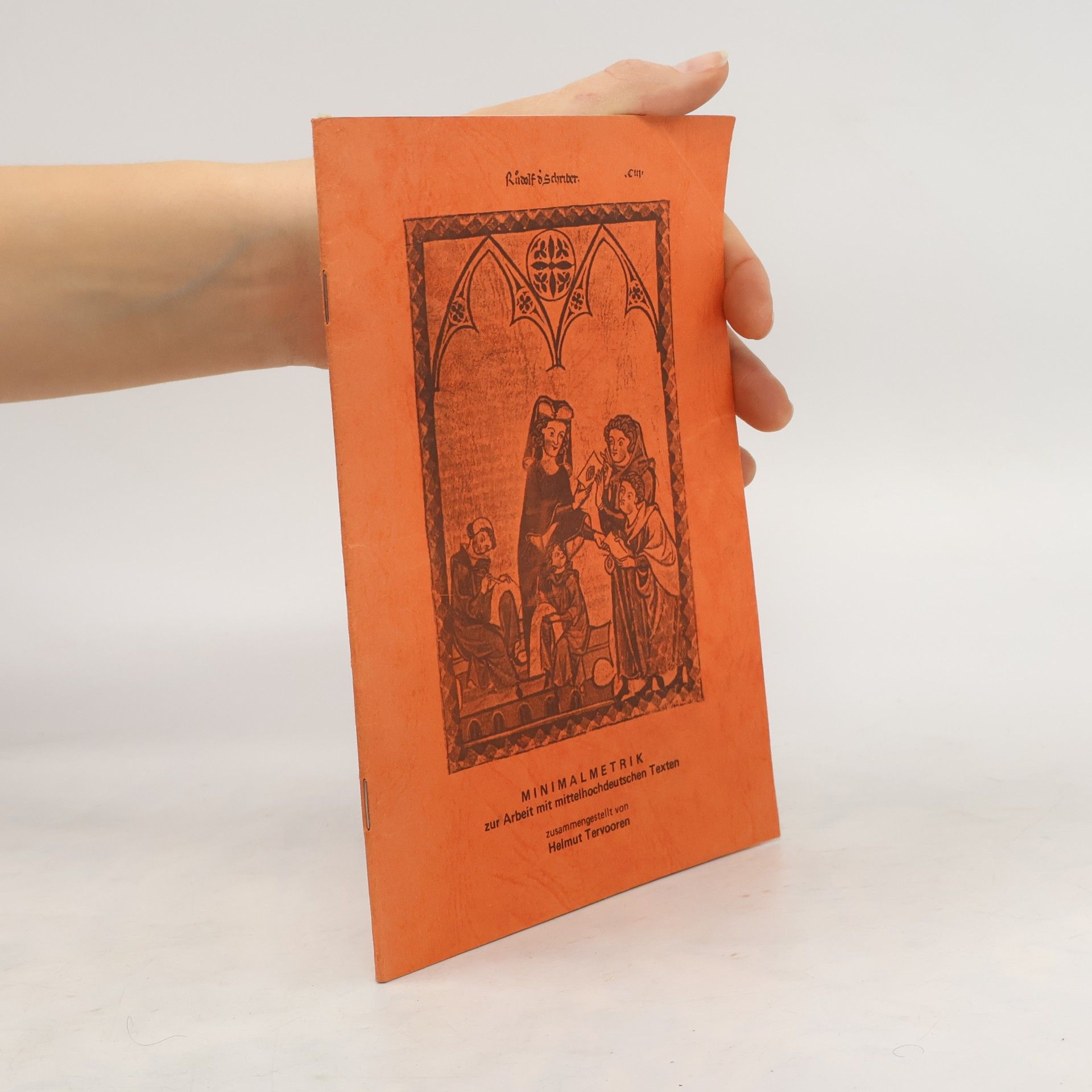
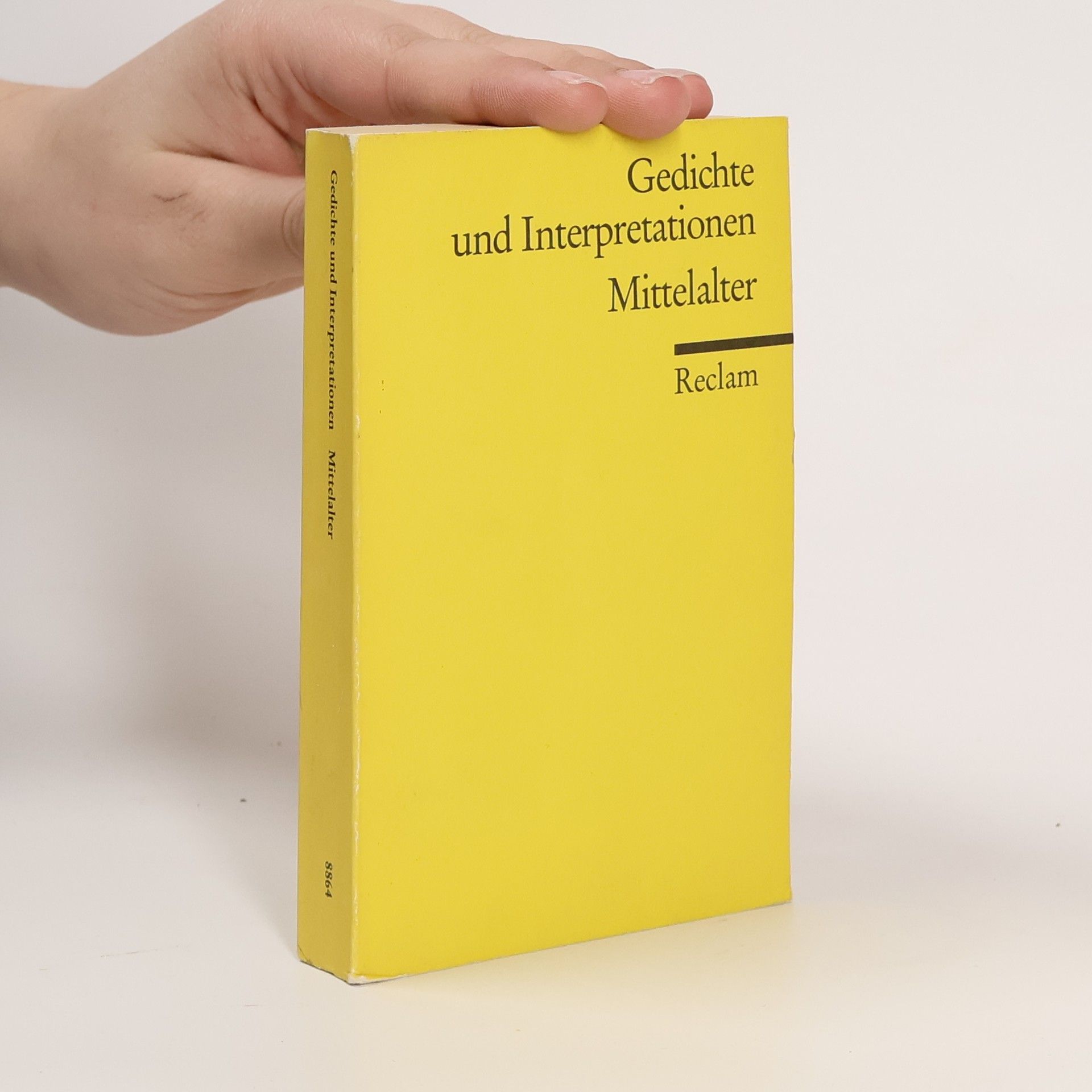
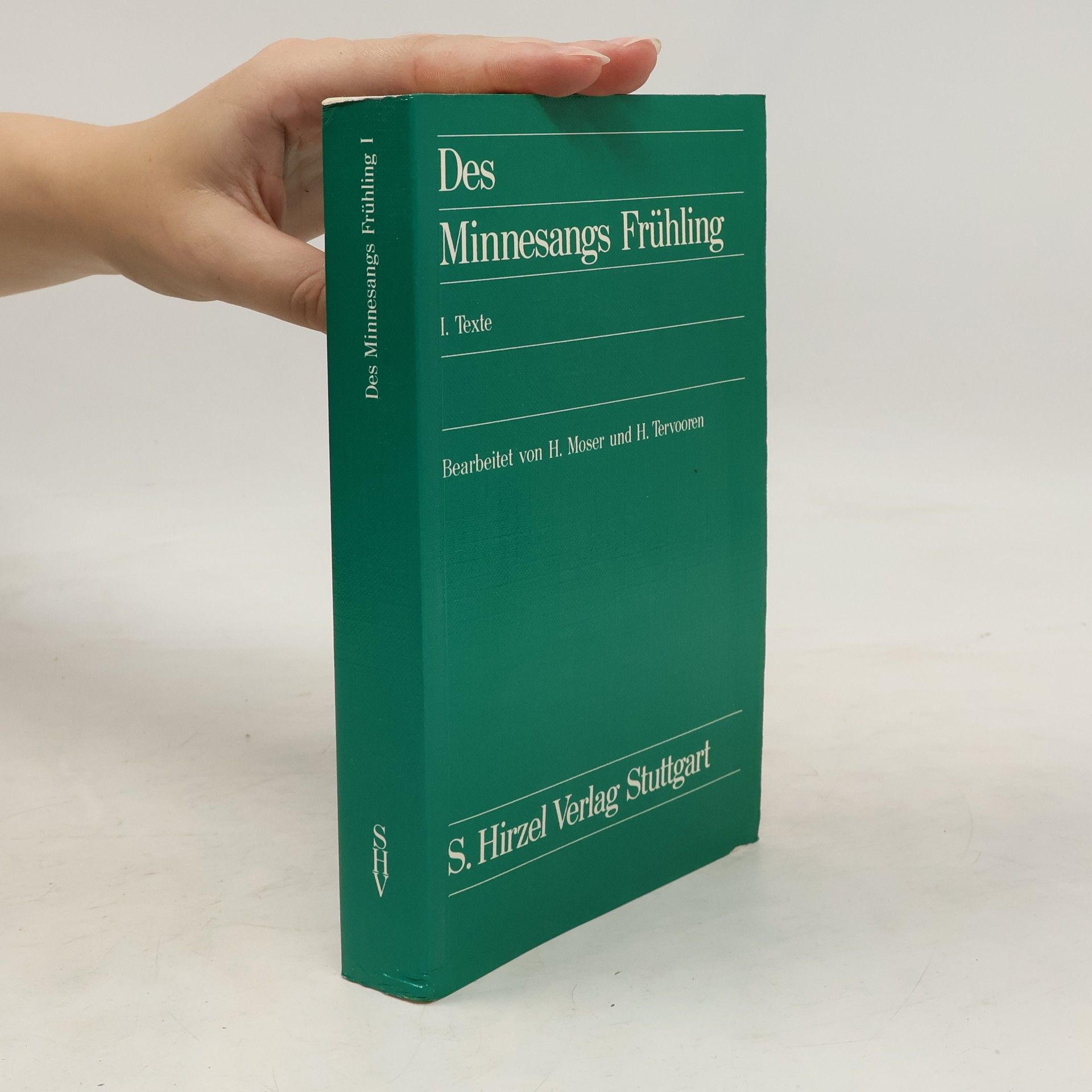
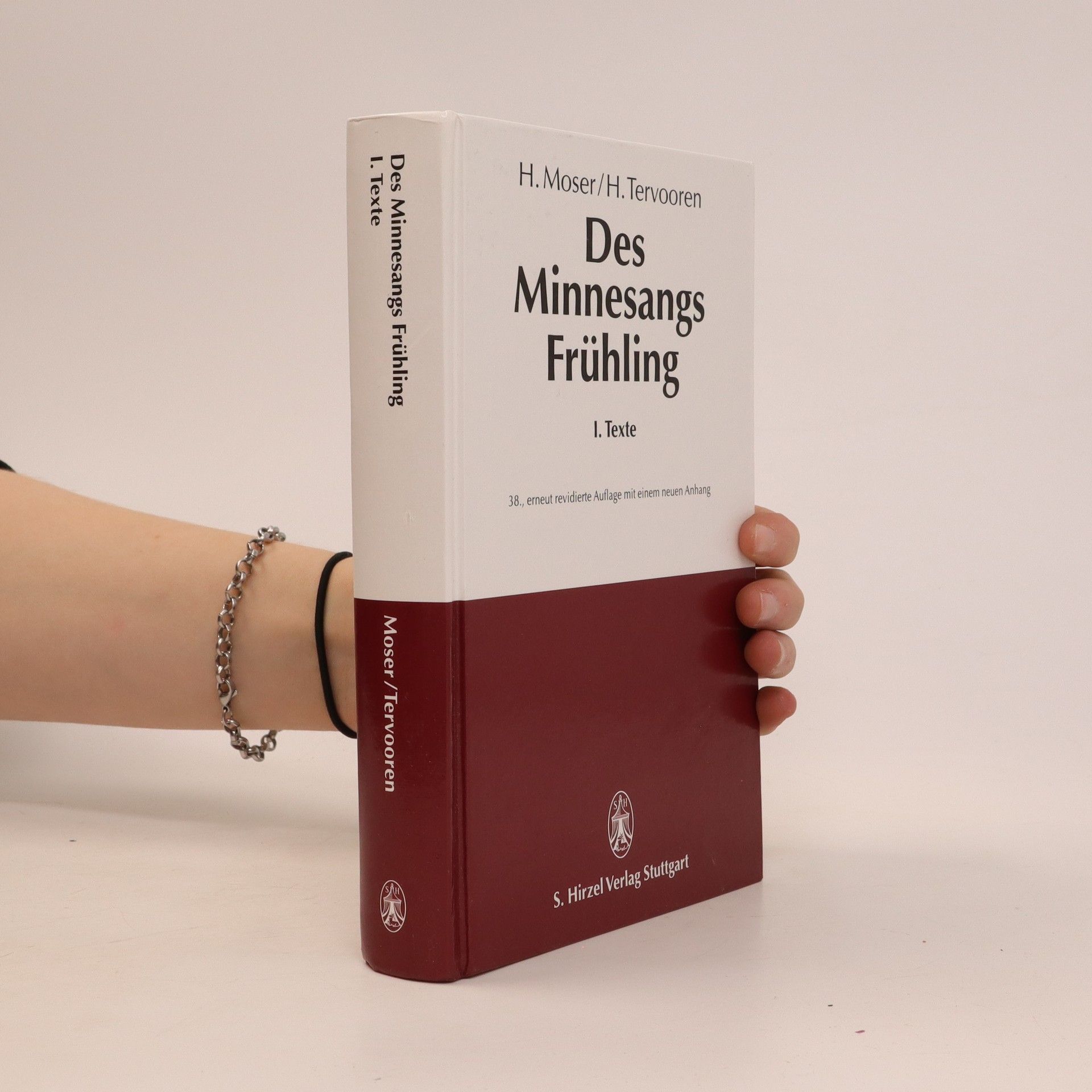
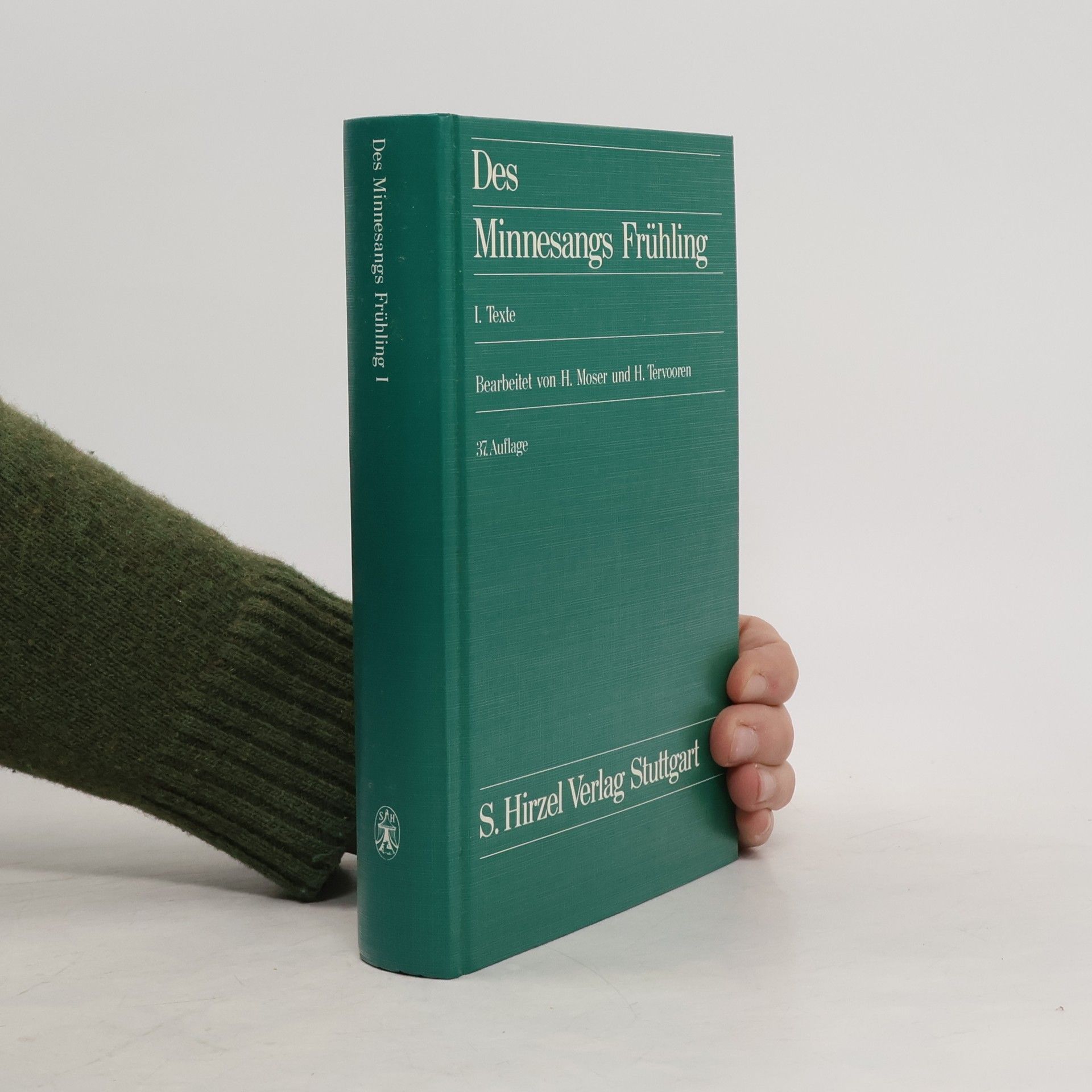
Unter Benutzung der Ausgaben von Karl Lachmann und Moritz Haupt, Friedrich Vogt und Carl von Kraus. Band I bietet die Liedtexte nach dem Prinzip der Leithandschrift, wobei die Bearbeiter dem handschriftlich uberlieferten Text so nahe wie moglich geblieben sind. Band II enthalt vor allem die Begrundung der Editionsprinzipien, die Liste der Handschriften mit der einschlagigen wissenschaftlichen Literatur, Erlauterungen, Melodien, Verzeichnisse der Strophenanfange und Eigennamen und die Streuuberlieferung (30 Faksimiledrucke aus 17 Handschriften). Dieser Band gehort zur vertieften Beschaftigung mit den Liedern untrennbar mit dem Textband zusammen. Band III umfasst die Kommentare; durch Register erschlossen und um einen Literaturschlussel erganzt.
Des Minnesangs Frühling. I.Texte
- 474 stránek
- 17 hodin čtení
Gedichte und Interpretationen Mittelalter
- 453 stránek
- 16 hodin čtení
Des Minnesangs Frühling
Unter Benutzung der Ausgaben von Karl Lachmann und Moriz Haupt, Friedrich Vogt und Carl von Kraus, bearb. von Hugo Moser und Helmut Tervooren
- 464 stránek
- 17 hodin čtení
