Als die französische Seite die Große Revolution von 1789 zum Kombattantendes Ersten Weltkriegs erklärt und die deutsche mit den »Ideenvon 1914« antwortet, entsteht ein Ideenkrieg von weitreichender Wirkung. 1914 gegen 1789 - damit stellte sich Deutschland gegen die Entente und ihre ideenpolitischen Ressourcen. 1789 symbolisierte den Westen, die Revolution und ihre Ideen wie Liberté, Égalité, Fraternité, Menschenrechte, Universalismus, Liberalismus, Demokratie und Sozialismus. 1914 hingegen war geprägt vom Augusterlebnis, dem plötzlichen Aufkommen eines enthusiastischen Nationalismus. Der Schock des Krieges entblößt dunkle Tendenzen, die weit über den Weltkrieg hinausreichen. Der Ideenkrieg wird zum Kampf um die wahre Revolution. Das neue Buch von Hans-Jürgen Schings verfolgt die Entwicklung des Weltkriegstopos und Ideenkriegs von den französischen Anfängen bei Henri Barbusse und Charles Péguy bis zum brutalen Ende im NS-Deutschland. Zu den beteiligten deutschen Autoren zählen Ernst Troeltsch, Werner Sombart und Johann Plenge sowie Oswald Spengler und der Fundamentalopponent Hugo Ball. Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen und Ernst Jüngers Revolutionsschriften (Der Arbeiter) erhalten neue Beachtung. Edgar Julius Jung, zuletzt Franz von Papens Redenschreiber, verkörpert das Endstadium der verdeckten Auseinandersetzung zwischen konservativer und nationalsozialistischer Revolution und wird am 30. Juni 1934 erschossen.
Hans Schings Knihy
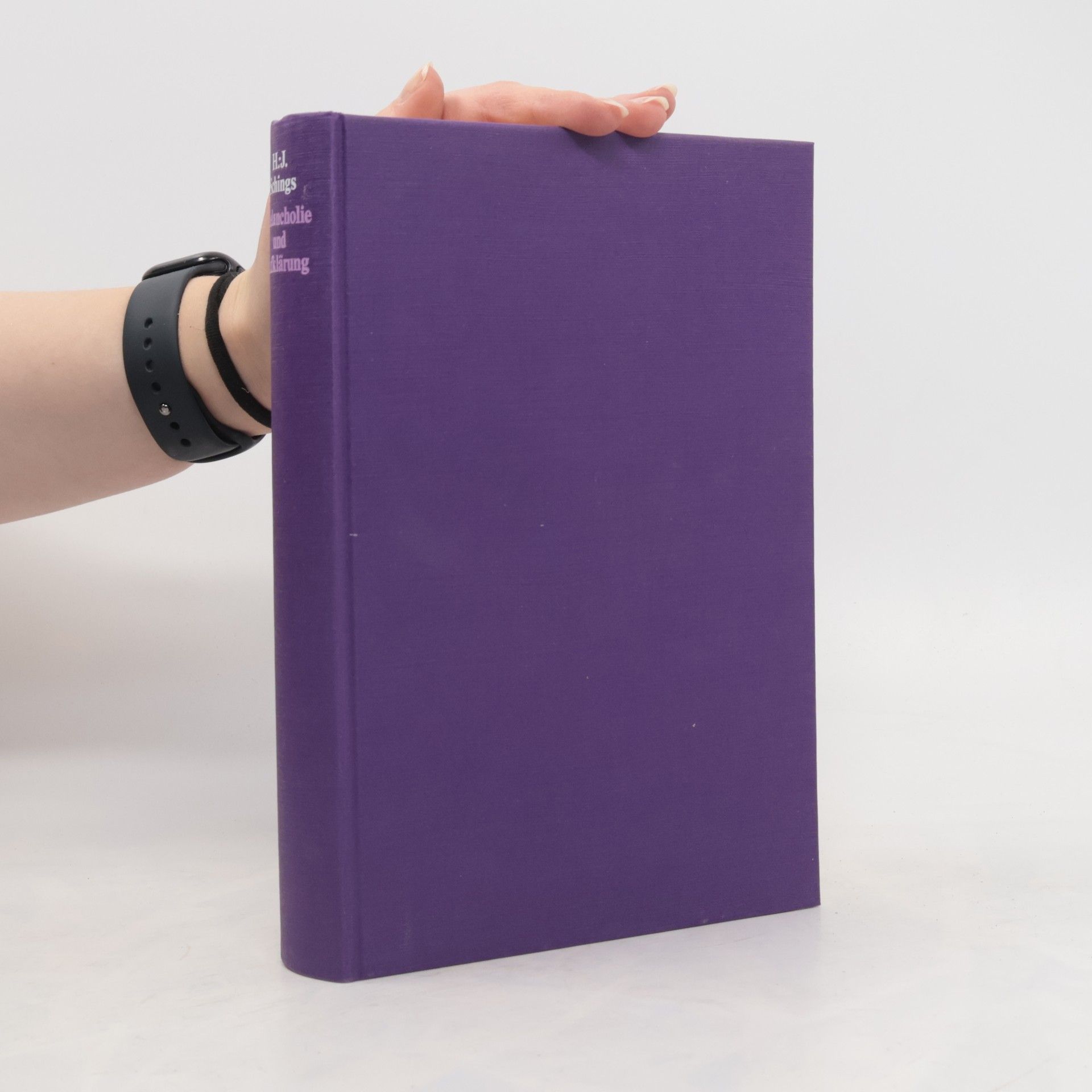
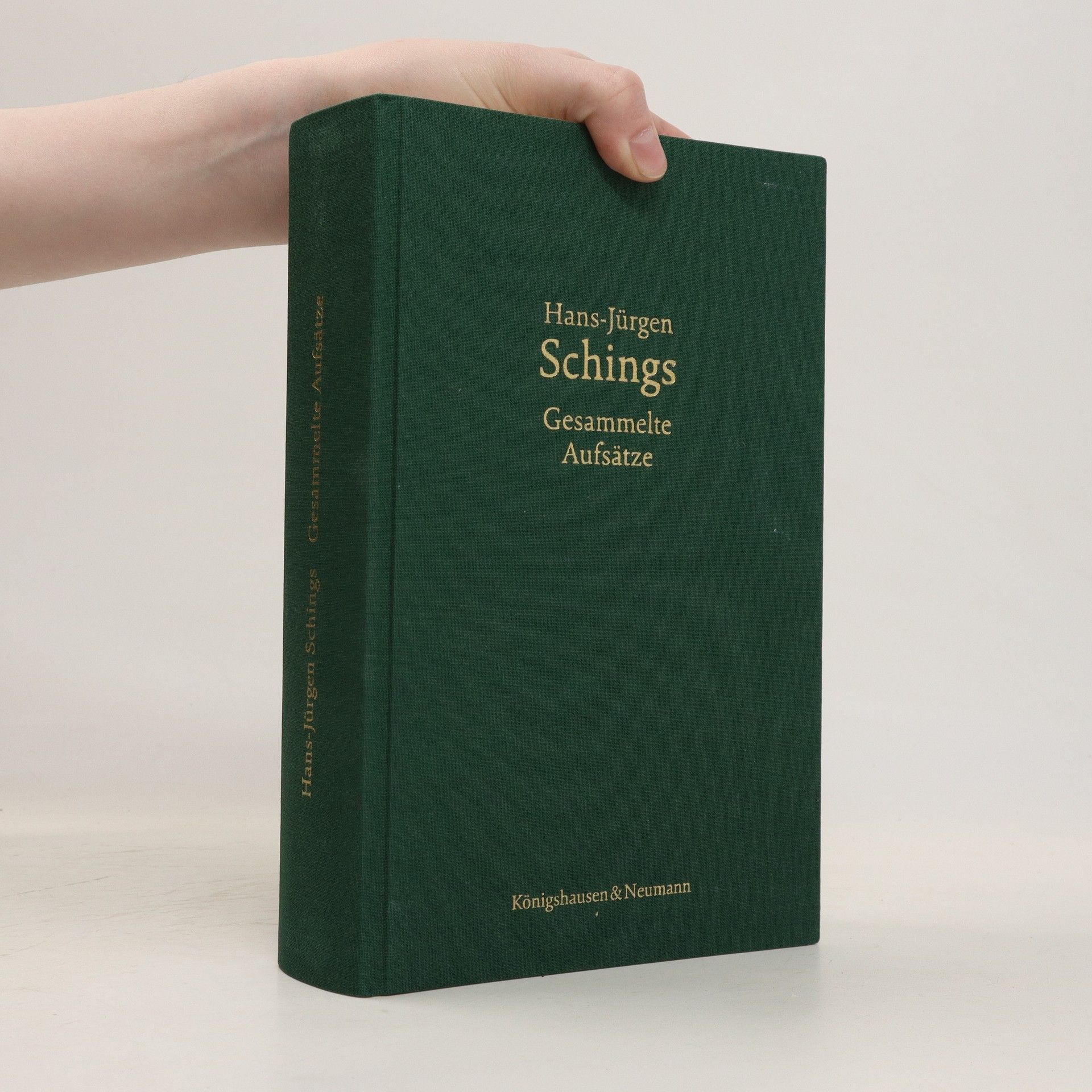

Gesammelte Aufsätze
- 566 stránek
- 20 hodin čtení
I. Barockes Trauerspiel – Andreas Gryphius, Catharina von Georgien. Oder Bewehrete Beständigkeit – Andreas Gryphius, Großmüttiger Rechts=Gelehrter / Oder Sterbender Æmilius Paulus Papinianus – Consolatio tragoediae. Zur Theorie des barocken Trauerspiels – Seneca-Rezeption und Theorie der Tragödie. Martin Opitz’ Vorrede zu den Trojanerinnen – Constantia und prudentia: Zum Funktionswandel des barocken Trauerspiels – Walter Benjamin, das barocke Trauerspiel und die Barockforschung – Groß genug von Sinn. Zum 400. Geburtstag von Martin Opitz – II. Schiller – Philosophie der Liebe und Tragödie des Universalhasses. Die Räuber im Kontext von Schillers Jugendphilosophie – Schillers Räuber: Ein Experiment des Universalhasses – Luise Millerin, die Aufklärung und das Gräßliche – Freiheit in der Geschichte. Egmont und Marquis Posa im Vergleich – Das Haupt der Gorgone. Tragische Analysis und Politik in Schillers Wallenstein – Schiller und die Aufklärung – III. Moderne – Allegorie des Lebens. Zum Formproblem von Hofmannsthals Märchen der 672. Nacht – Lyrik des Hauchs. Zu Hofmannsthals Gespräch über Gedichte – Hier oder nirgends. Hofmannsthals Augenblicke in Griechenland – Die Fragen des Malte Laurids Brigge und Georg Simmel – Intransitive Liebe. Herkunft und Wege eines Rilkeschen Motivs. Mit einem Ausblick auf Georg von Lukács – Bert Brecht und die Heiterkeit der Kunst – Die Methode des Equilibrismus. Zu Thomas Bernhards Immanuel Kant
Melancholie und Aufklärung
- 476 stránek
- 17 hodin čtení