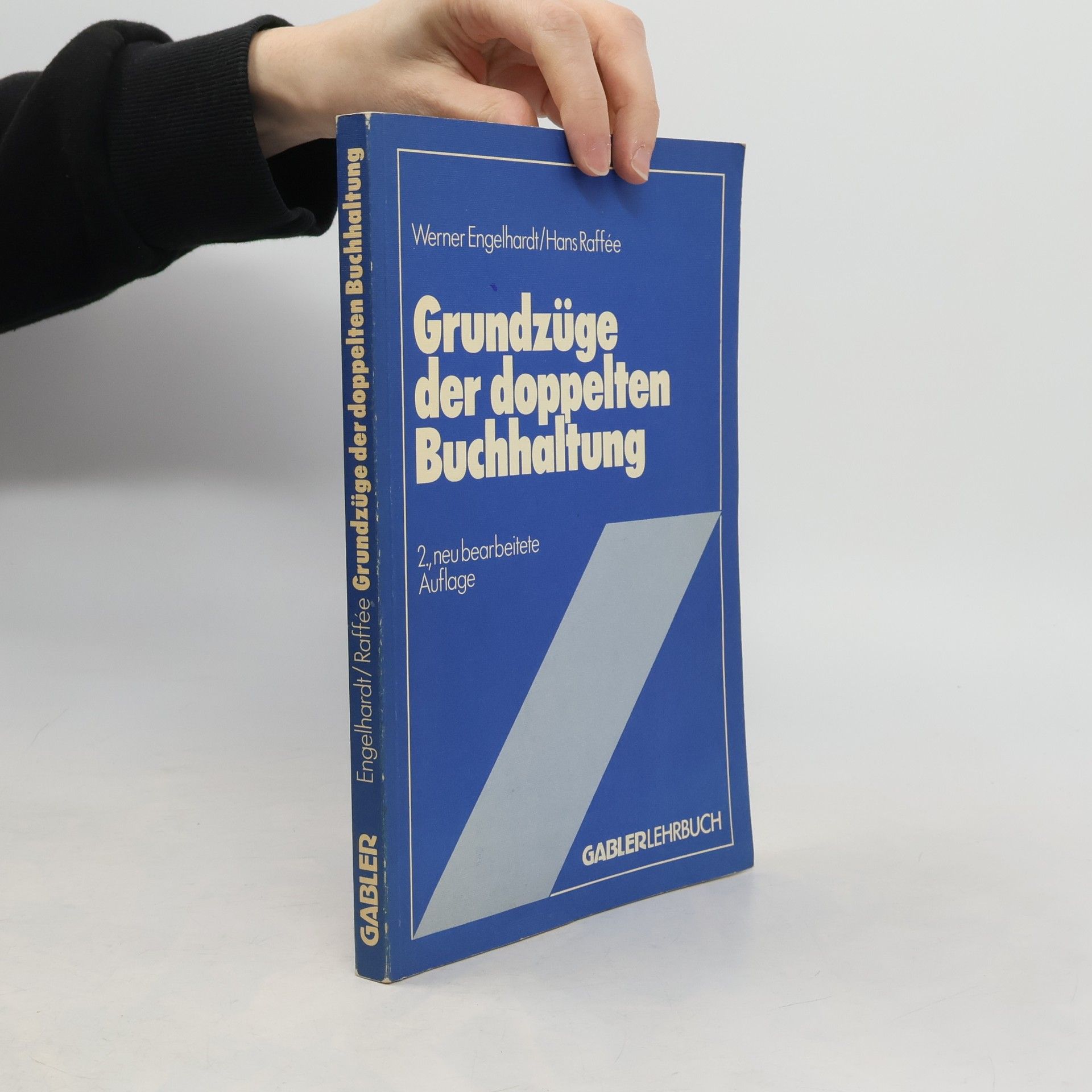Grundzüge der doppelten Buchhaltung
- 196 stránek
- 7 hodin čtení
Dieses Standardwerk macht systematisch mit der doppelten Buchhaltung vertraut, ohne dass buchhalterische Vorkenntnisse erforderlich sind. Der didaktisch geschickt aufbereitete Lernstoff wird durch eine Vielzahl von Beispielen unterstützt. Zu jedem Kapitel sind kurze Übungsaufgaben mit Lösungen angegeben, die eine selbstständige Kontrolle des Lernerfolges ermöglichen. Zielsetzung der "Grundzüge der doppelten Buchhaltung" ist die Vermittlung der Buchungstechnik vor dem Hintergrund einer Einführung in die theoretischen Grundlagen der Buchhaltung und Bilanz. Damit bietet dieses Lehrbuch eine einzigartige Synthese von Buchhaltungstechniken mit bilanzanalytischen und bilanztheoretischen Zusammenhängen.Die achte Auflage berücksichtigt insbesondere die rechtlichen Änderungen durch das BilMoG und seine Umsetzung im HGB sowie die relevanten Neuerungen aus dem Unternehmenssteuerreformgesetz 2008. Darüber hinaus sind alle wichtigen Änderungen aus EStG und EStR eingearbeitet.