Klaus Hornung Knihy
26. červen 1927 – 13. prosinec 2017


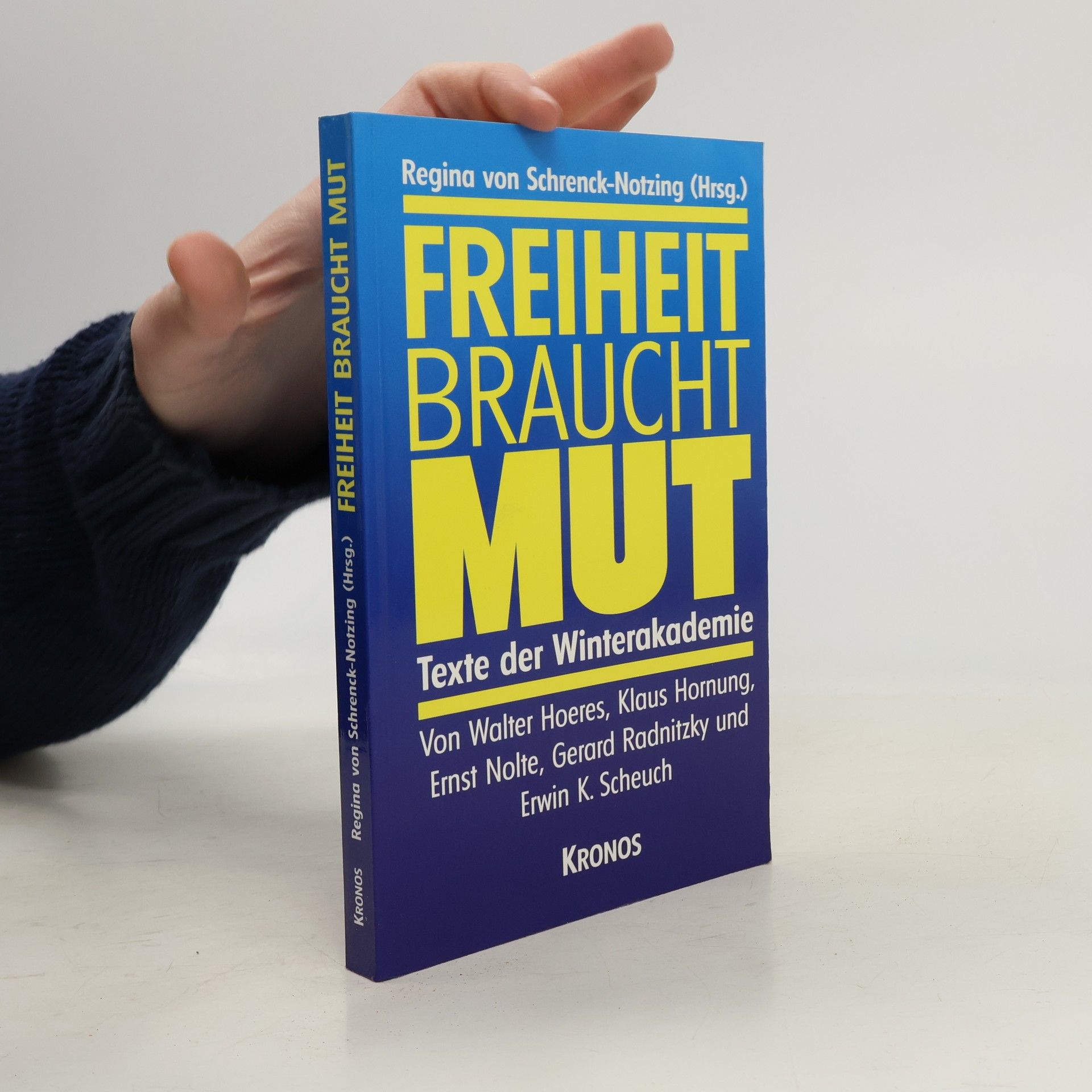
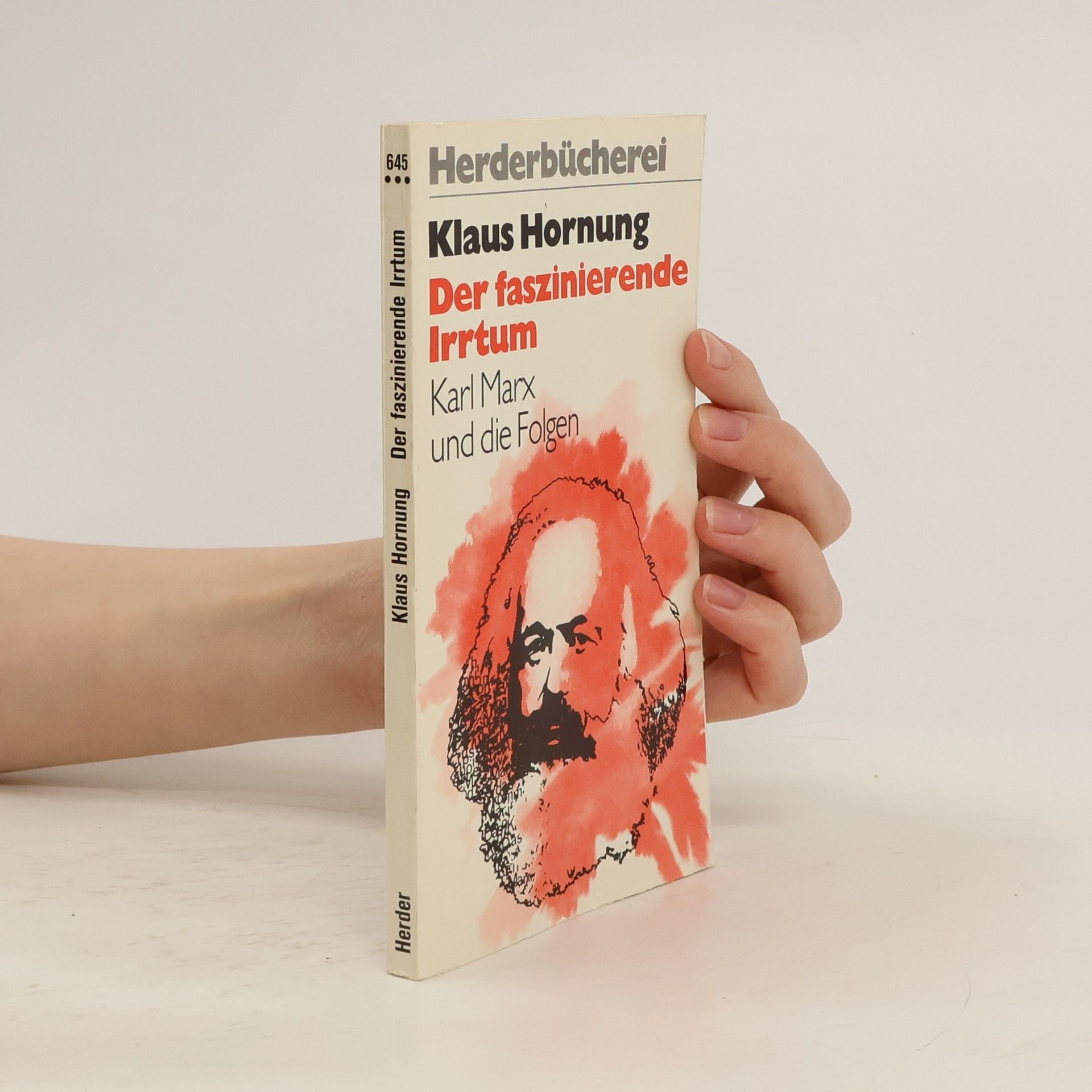
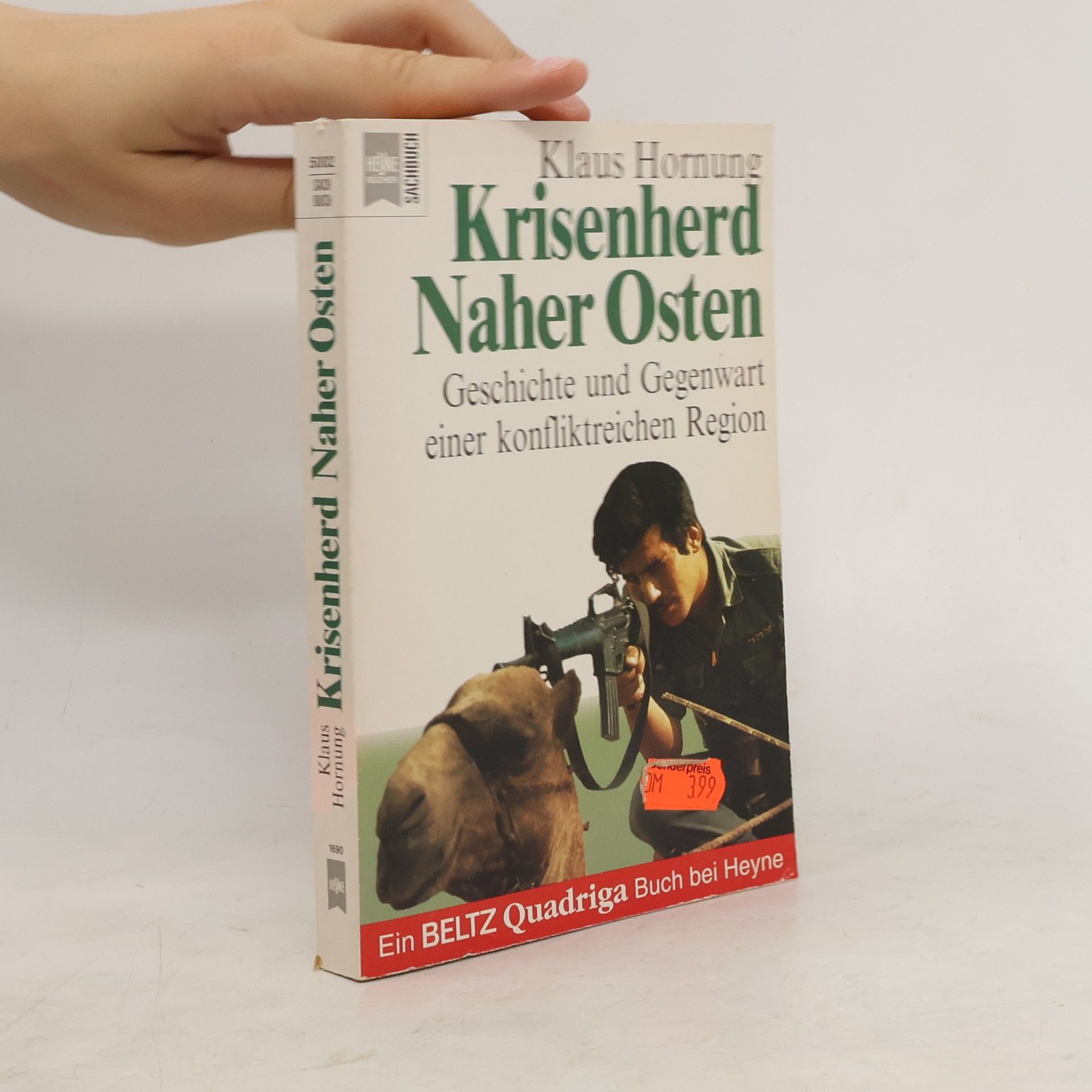
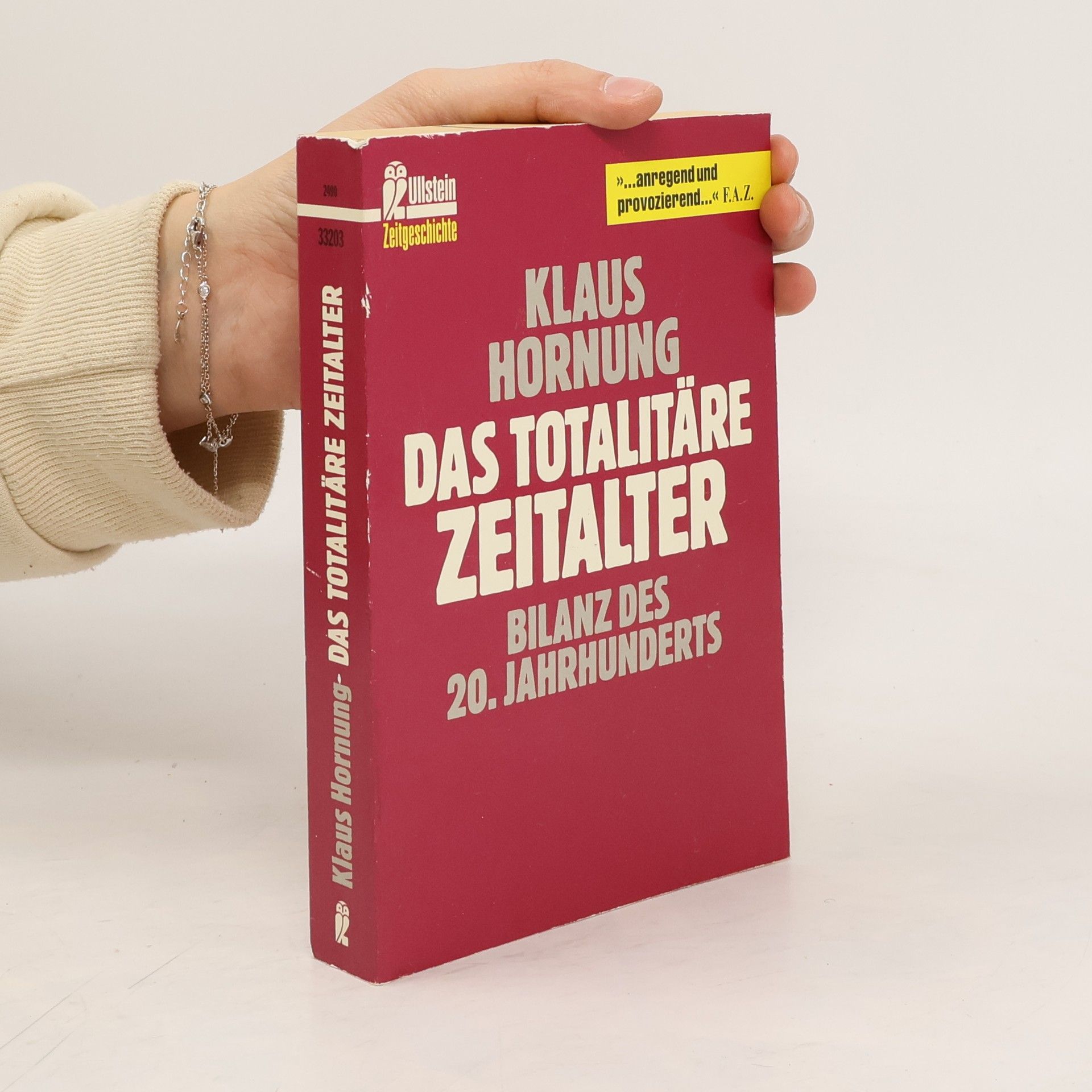
Geschichte, Probleme und Bedeutung des Grossraums Naher/Mittlerer Osten und Nordafrika: eine Darstellung, die besonders Strukturen und Zusammenhänge - auch mit der Weltpolitik - deutlich herausarbeitet.
JF-Sommeruniversität 1993 in Ravensburg
- 221 stránek
- 8 hodin čtení
SZW-Dokumentation - 14: Bundeswehr im geschichtlichen Niemandsland?
Zum Verhältnis der Bundeswehr zu Wehrmacht und Reichswehr
- 210 stránek
- 8 hodin čtení
German
