Ingeborg Milz Knihy
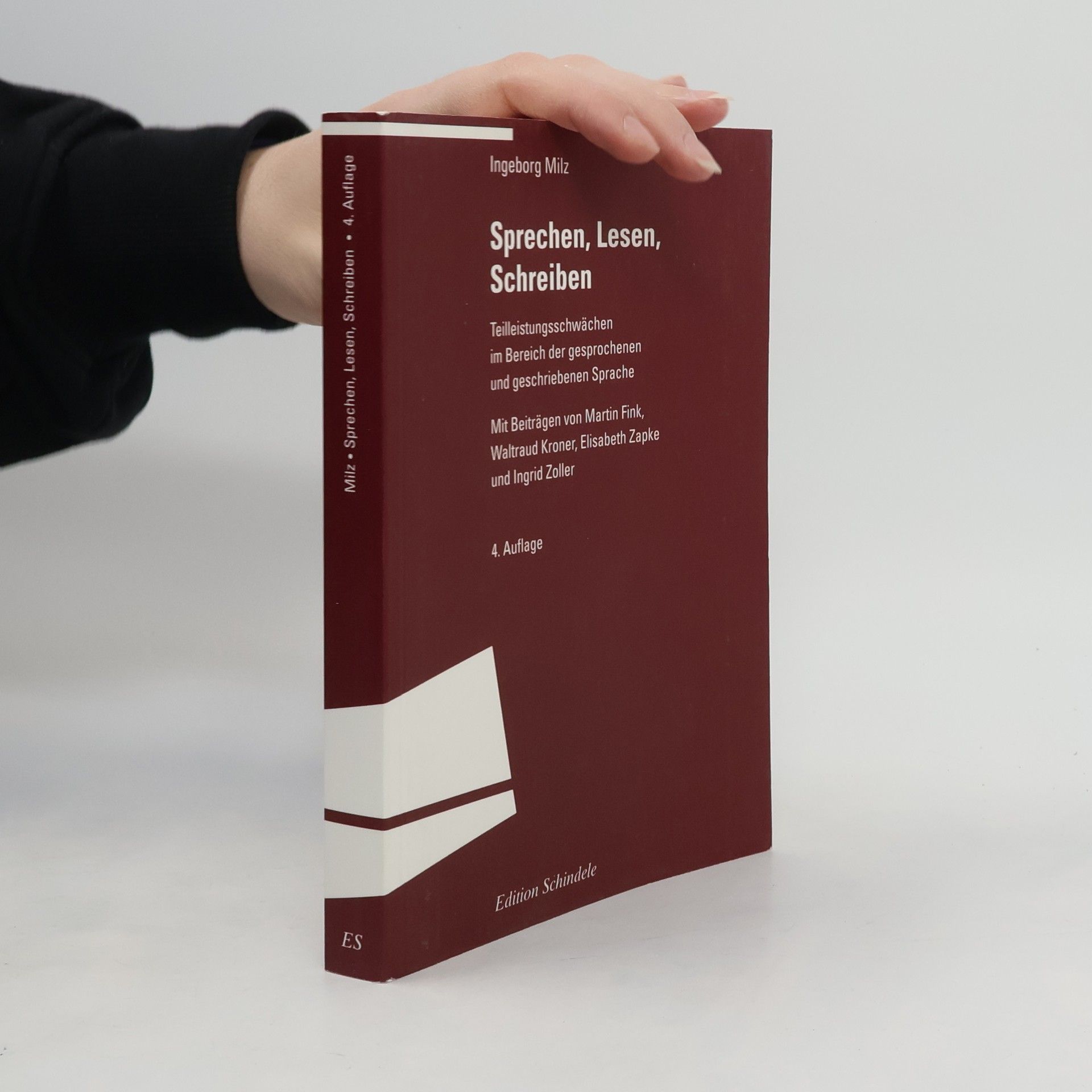

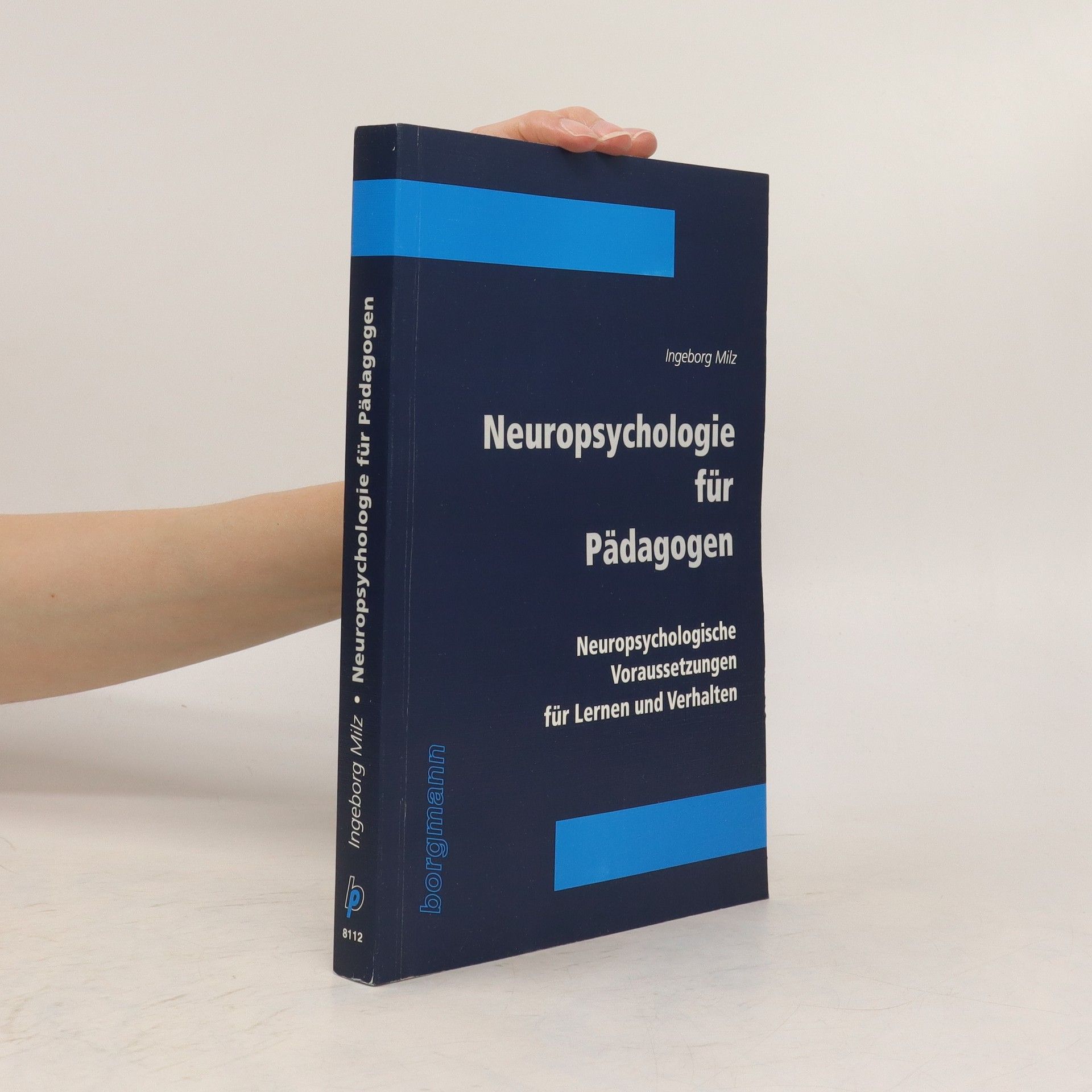

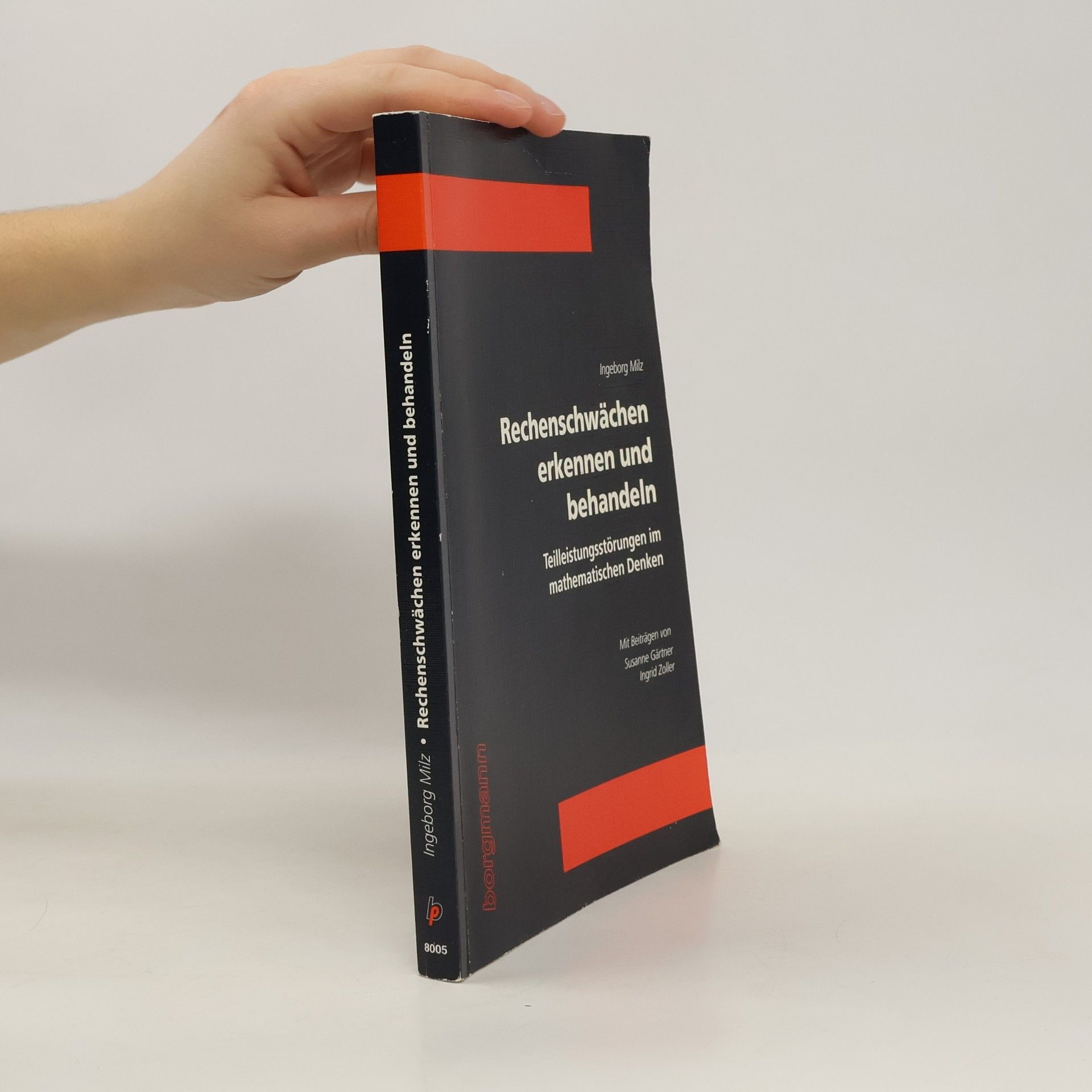
Die Autorin wendet sich an Menschen, die zwar mit der Erziehung von Kindern zu tun haben, im Allgemeinen aber weder etwas mit der Neurologie noch im engeren Sinne mit der Psychologie als theoretischer Wissenschaft. Die gegenwärtige Situation in den Kindergärten, im Vorschulbereich wie in der Schule zeigt aber, daß es immer mehr Kinder gibt, die wegen ihrer Problematik, sei es im Lernen oder im Verhalten eine gewisse Hilflosigkeit bei den Pädagogen auslösen. Hier können Informationen hilfreich sein über die Zusammenhänge neurologischer und psychologischer Reifungsprozesse als Voraussetzung für Lernen und Verhalten; über Auswirkungen von Körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen, die im Laufe der kindlichen Entwicklung auftreten können und über heilpädagogische Möglichkeiten und therapeutische Konzepte als „Entwicklungshilfe“. In diesem Buch werden die Voraussetzungen für Lernen und Verhalten unter neuropsychologischem Gesichtspunkt betrachtet und dabei Beeinträchtigungen, Entwicklungsverzögerungen oder -störungen in ihren vielfältigen Auswirkungen dargestellt. Gleichermaßen werden auch Grundzüge, Prinzipien und Konzepte als Grundlage einer neuropsychologisch/heilpädagogischen Intervention aufgezeigt. Damit werden die Inhalte der Seminare, die im Zusammenhang mit der Ausbildung zur Erlangung des M.-Frostig Zertifikates von der Autorin gegeben wurden, ergänzt und vertieft.
Sprechen, Lesen, Schreiben
Teilleistungsschwächen im Bereich der gesprochenen und geschriebenen Sprache - 4. Auflage
- 324 stránek
- 12 hodin čtení