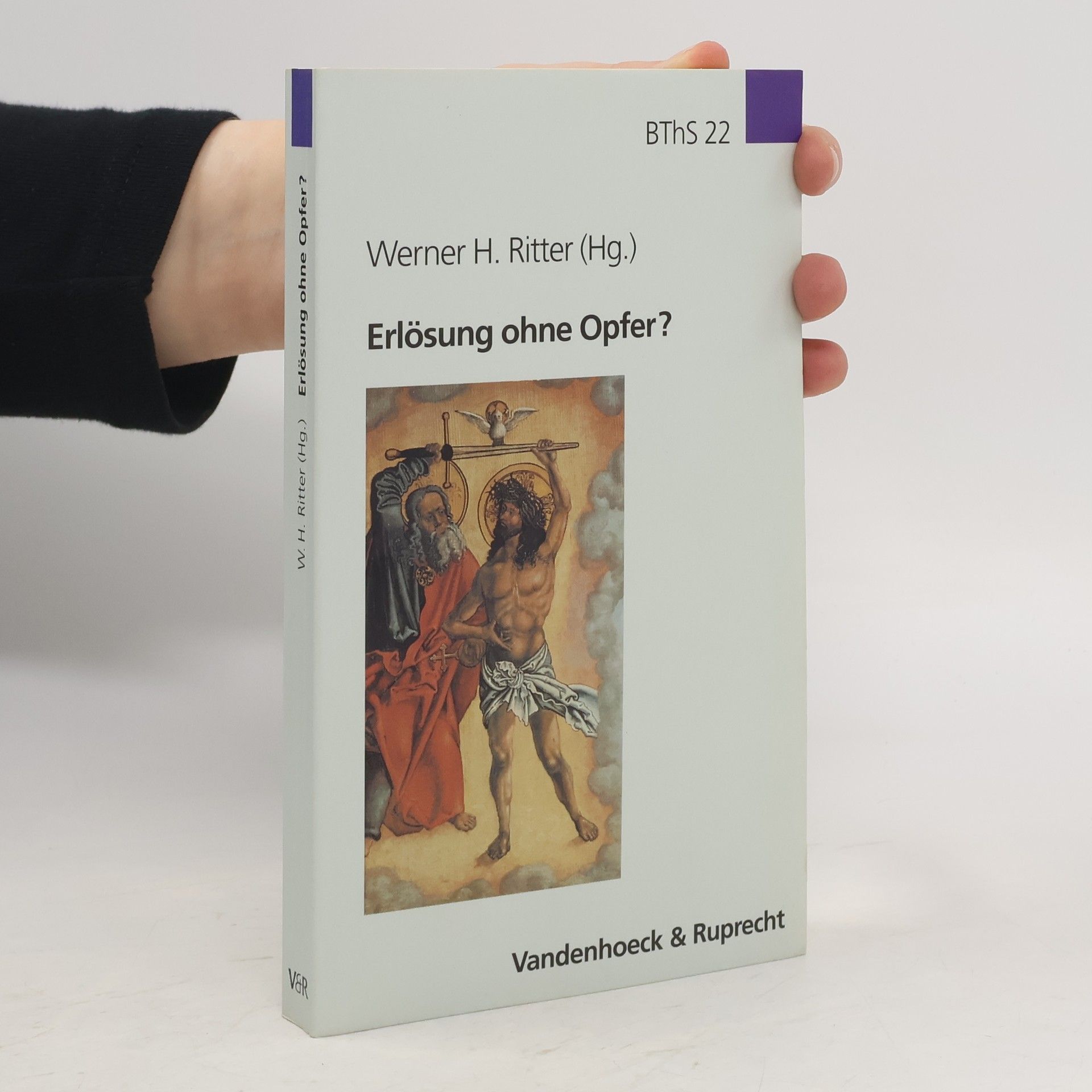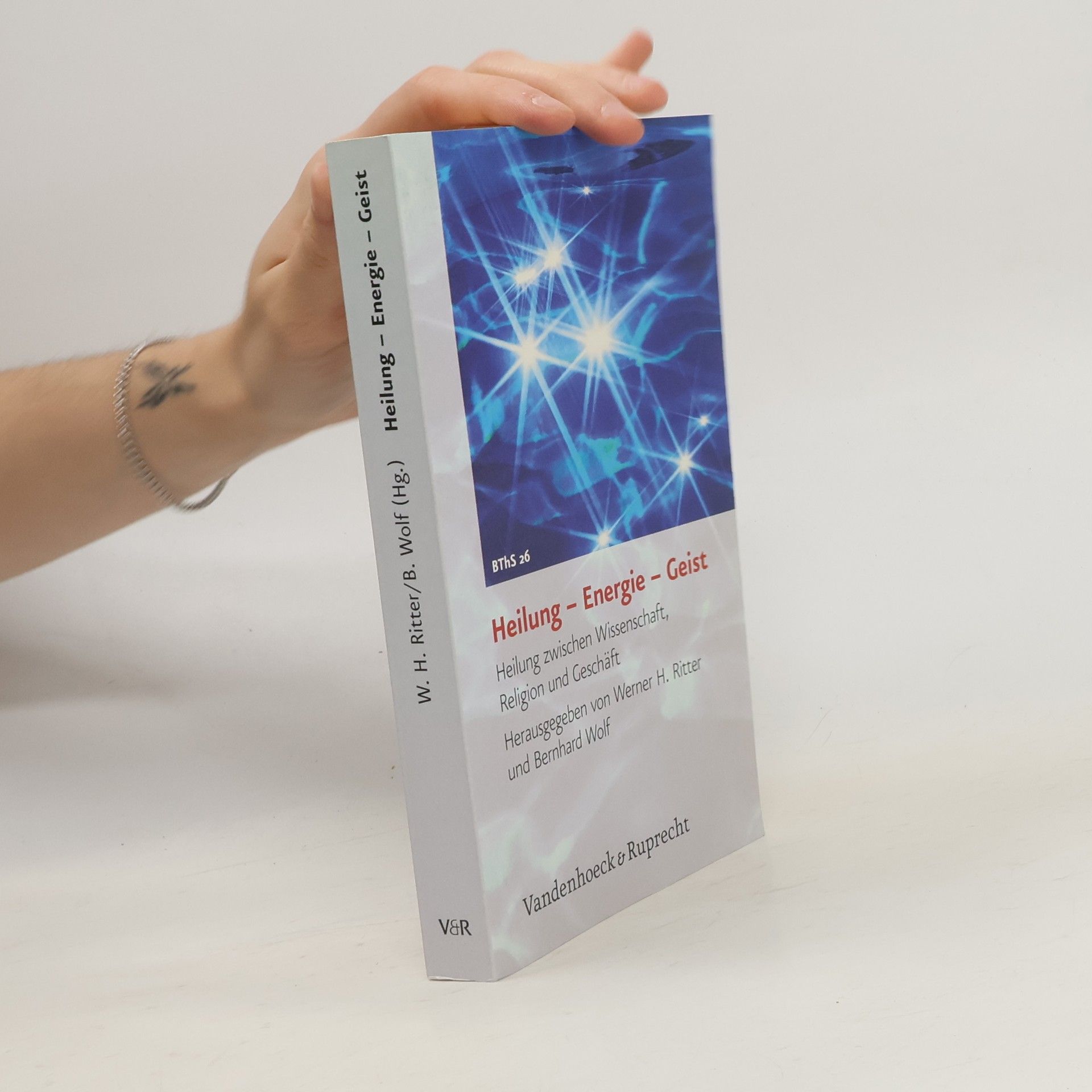Heilung - Energie - Geist
- 284 stránek
- 10 hodin čtení
Der Wunsch nach einer »anderen Medizin« wächst durch Hoffnungen und Enttäuschungen, die sich mit der modernen Medizin verbinden. Und so wurde das Heilen jüngst in unterschiedlichen Zusammenhängen als verloren gegangene Kunst wieder entdeckt und öffentlich thematisiert. Unkonventionelle Heilungsverfahren sind aber nicht nur eine Chance, sondern auch eine Herausforderung für die sogenannte Schulmedizin, ebenso wie für die Theologie, die Psychologie oder sogar die Jurisprudenz. Erstmals erschließen nun namhafte Wissenschaftler das Thema Heilung multidisziplinär und rücken es in das Spannungsfeld von Energie und Geist. Biblische Wurzeln von Heilung kommen dabei ebenso zur Sprache wie medizinisches Heilen, Lebenshilfe, Heilung durch Energien oder durch Geister. Phänomene und Begriffe, die im Kontext von Heilung immer wieder in unterschiedlichen Konnotationen auftauchen, werden auf ihre medizinische, theologische, geistes- und naturwissenschaftliche Konsistenz, Trag- und Anschlussfähigkeit hin geprüft. Letztlich geht es um die fundamentale Frage, mit welchen Bedingungs- und Einflussfaktoren wir bei Heilungsprozessen rechnen können oder sogar müssen.