Dietrich Herzog Knihy
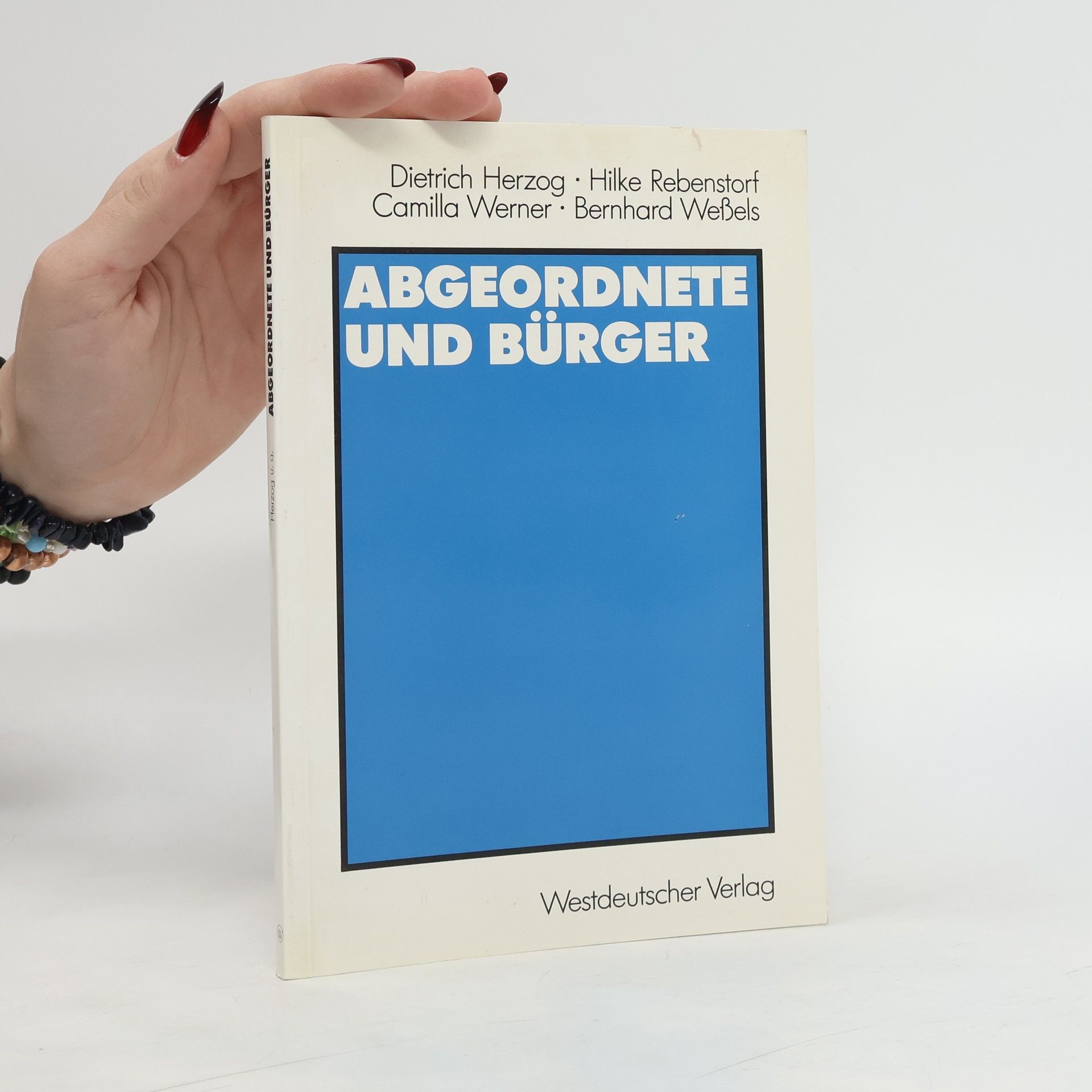
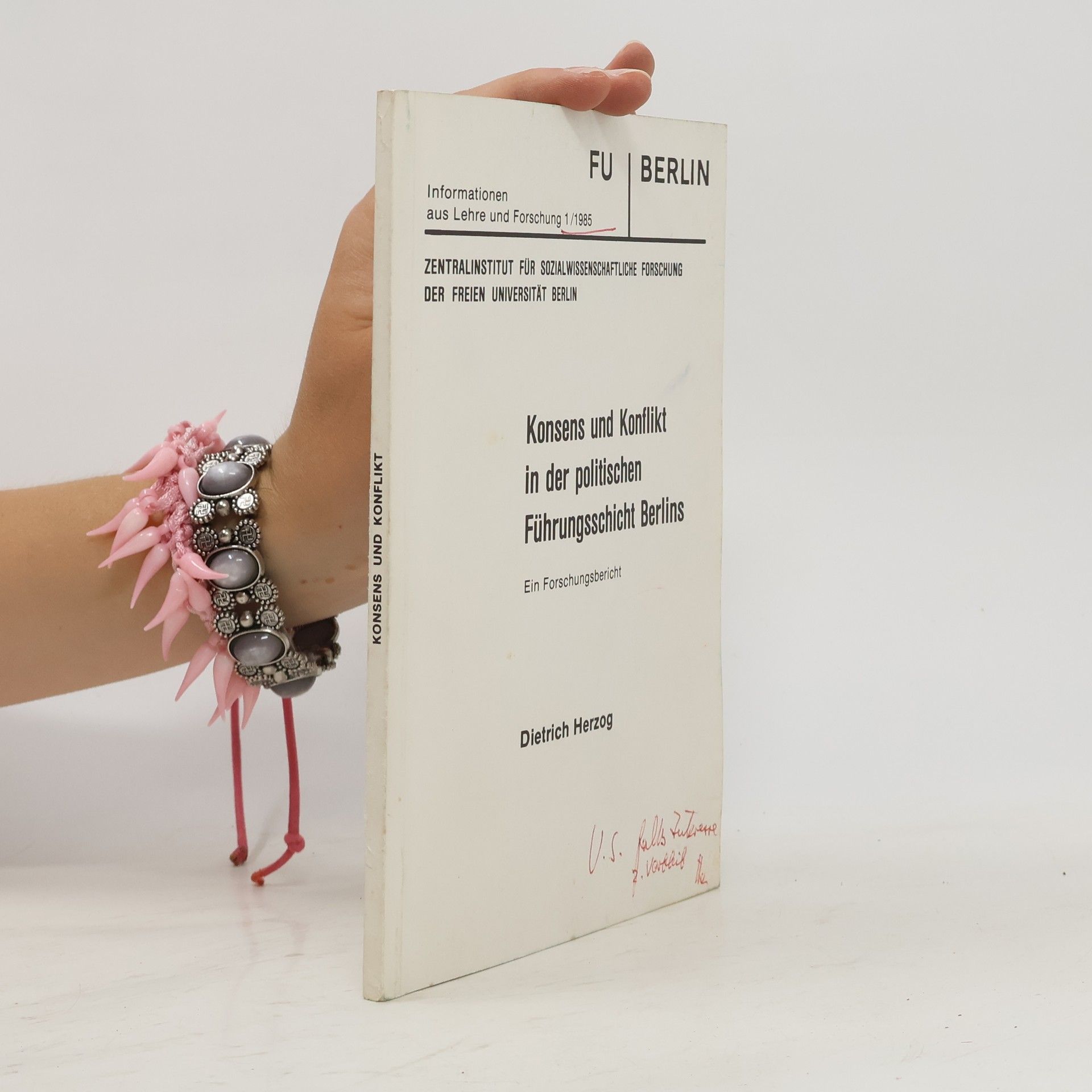
Inhaltsverzeichnis1. Methodische Anlage, technische Durchführung und Repräsentativität der Untersuchung.2. Kommunikationsbeziehungen zwischen Bundestag und Gesellschaft.3. Politische Einstellungen von Bürgern und Abgeordneten.4. Rollenverständnis, Motivationen und Tätigkeitsschwerpunkte.5. Kontakte zwischen den Fraktionen.6. Wie informieren sich Abgeordnete?.7. Zeitbudget und Arbeitsbedingungen.8. Der Bundestag im parlamentarischen Regierungssystem.9. Handlungsspielraum und Aufgabenerfüllung des Bundestages.10. Einstellungen zur Parlamentsreform und zu plebiszitären Verfahren.Die Autoren.