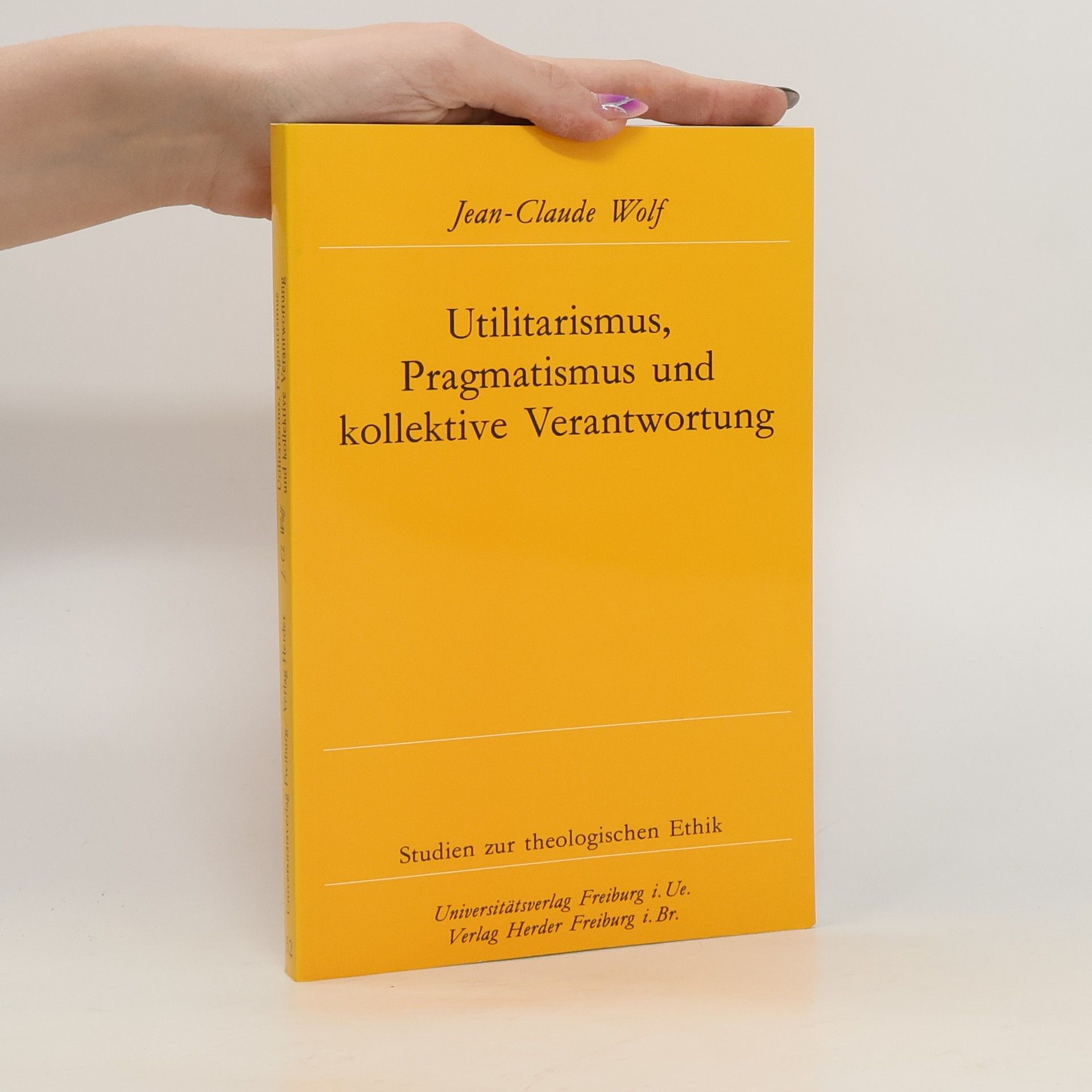Die Erzählung von Hiob thematisiert die existenziellen Fragen des Leidens und der Gerechtigkeit. Hiobs leidenschaftliche Dialoge mit seinen Freunden beleuchten die tiefgreifenden Zweifel an Gottes Plan, während er auf eine direkte Antwort von Gott hofft. Die Reflexionen ziehen Gedanken führender Denker wie Kierkegaard und Buber heran, um die Möglichkeit der Kommunikation mit Gott in der modernen Gesellschaft zu hinterfragen. Das Werk verbindet antike Tradition mit zeitgenössischen philosophischen Überlegungen und lädt zur Auseinandersetzung mit dem Glauben und der menschlichen Existenz ein.
Jean Wolf Knihy
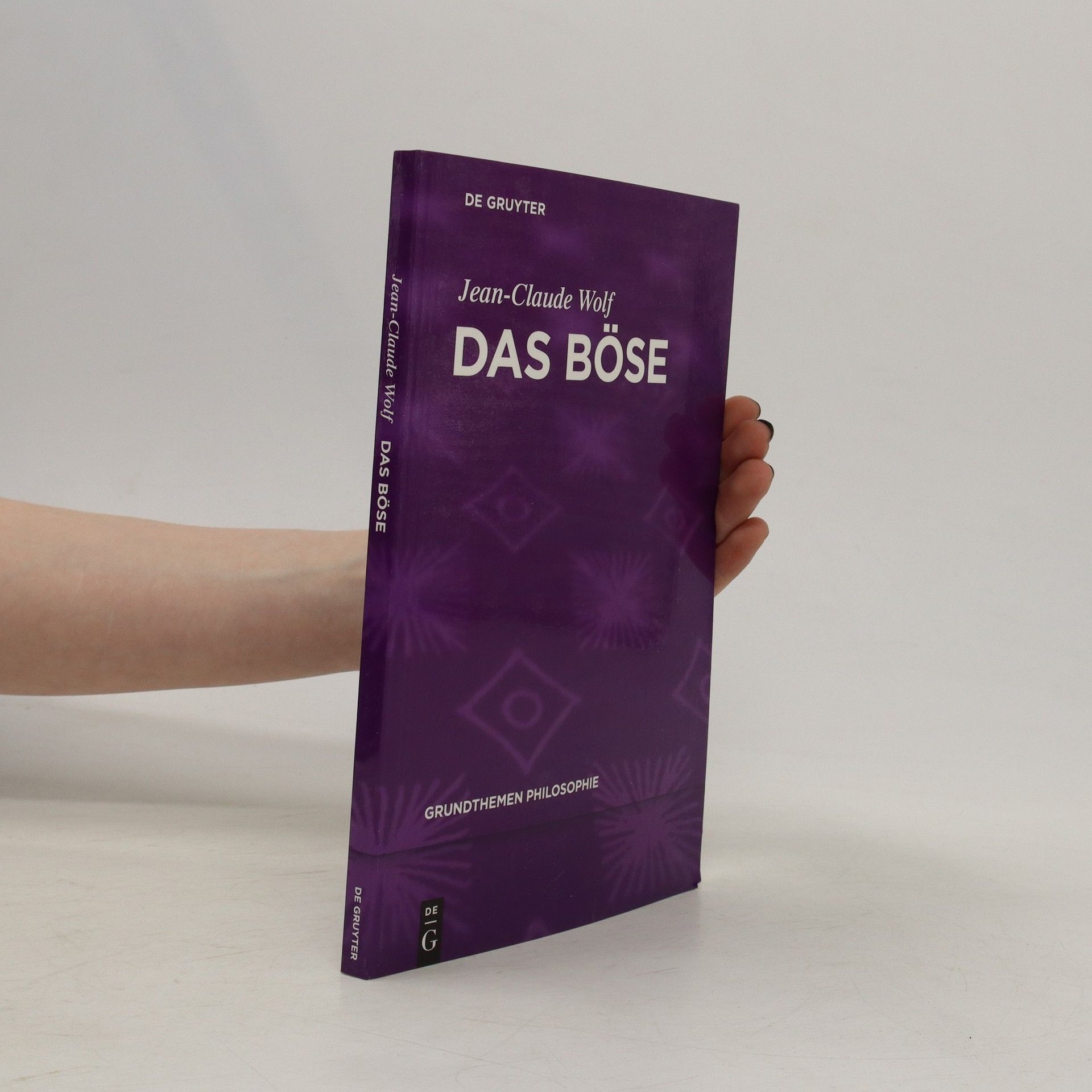

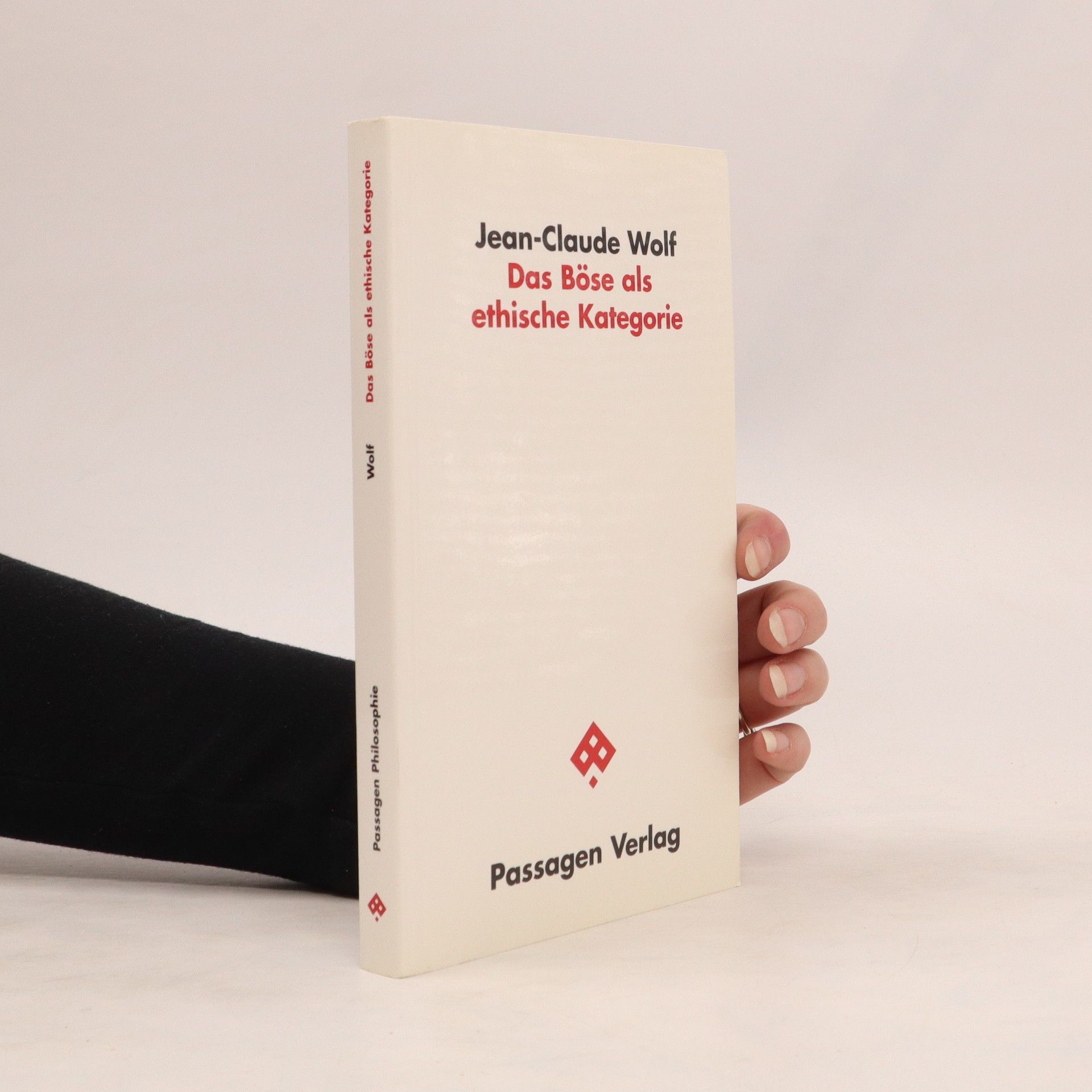



Zum Gott der Philosophen kann man nicht beten. Die Philosophie seit Spinoza und Kant vermeidet das Thema des Gebets. Das naive Bittgebet gilt als unwurdig und beschamend. Philosophie darf nicht erbaulich sein. Frommigkeit scheint moderne Intellektuelle v.a. zu langweilen. Doch es gibt auch reaktionare Gegenstimmen wie Sen Kierkegaard und Franz von Baader, die eine Philosophie des Gebets entwickelt haben. Die Sinnspruche von Angelus Silesius evozieren eine Nahe des Gebets zur Lyrik. In diesem Essay geht es nicht einfach um eine Apologie des Betens, sondern auch darum, einige der tieferen geistigen und affektiven Motive, die das Beten storen und verhindern, zu untersuchen. Jean-Claude Wolf war von 1993 bis 2018 Ordinarius fur Ethik und politische Philosophie an der Universitat Misericorde in Freiburg in der Schweiz. Zu seinen letzten Veroffentlichungen gehort Pantheismus nach der Aufklarung. Religion zwischen Haresie und Poesie (2012).
Jean-Claude Wolf legt mit diesem Essay uber Gebet und Poesie in den Psalmen keine Abhandlung, sondern einen Gesprachsanfang vor. Warum gerade ein Essay uber die Psalmen? Wurden diese nicht schon ausfuhrlich gelehrt und bis zum Uberdruss erbaulich kommentiert? Eine philosophische Antwort auf diese Frage fuhrt dabei in eine Serie von Ist es gelungen, Gott zu toten, den Glauben zu uberwinden? Haben die Errungenschaften der Moderne dazu gefuhrt, dass der Traum von der Nahe des Fernen ausgetraumt ist, weil er technisch realisiert wird? Mussen wir noch beten, obwohl wir uns durch Medien und virtuelle Kommunikation immer naher rucken? Haben nicht immer mehr Menschen durch Reisen raumliche Ferne, durch Bildung und Wissen zeitliche Ferne uberwunden? Bleibt eine Sehnsucht nach (korperlicher? seelischer?) Nahe, die sich nicht technisch realisieren lasst? Wie ist es moglich, dass der EWIGE, der im Gebet angerufen wird, zugleich fern und nah ist?
Das Böse verstehen heißt, die menschliche Freiheit als Wagnis zu verstehen. Wer die Freiheit verteidigt, muss die Realität des Bösen akzeptieren. Die Genese des Bösen aus moralischen Motiven lässt sich vielfältig variieren. Der Autor blättert, beginnend bei Kant und Schelling, eine Kulturgeschichte des Bösen auf. Die ästhetische Rehabilitierung des Bösen als das Interessante darf nicht verwechselt werden mit einem ethischen Freispruch für das Böse, wie Oscar Wildes „Dorian Gray“ bezeugt. Bei Nietzsche wird die Gestalt des Immoralisten zum Grenzgänger am Rande der Herde, der mit der wachsenden Einsamkeit auch die Chancen zur Mitteilung einbüßt. Die Diagnose des Bösen als Krankheit verfehlt den Anteil an freier Entscheidung. Selbstlosigkeit muss nicht und darf nicht das dominierende Motiv sein. Ein wohlverstandener Egoismus kann vor den Exzessen und Entgleisungen des Moralismus bewahren. Im Spiel mit Ambivalenzen und Abgründen kulminiert dieser moralkritische Essay in einem Plädoyer für eine egoistische Ethik.
Das Böse
- 181 stránek
- 7 hodin čtení
Im ersten Teil werden die Anfänge und Verzweigungen des Bösen dargestellt. Das Böse beschreibt schreckliche Taten und Unterlassungen und verweist auf eine Symbolik des Unreinen, Dunklen und Inferioren und auf die harten Realitäten von Knappheit und Konkurrenz; es spiegelt sich in Lasterkatalogen und in Ausdrucksformen des Neids, der Grausamkeit, des Hasses, der Zerstörungslust und des Fanatismus wider. Im zweiten Teil geht es um Formen der Etablierung des Bösen durch Gewohnheiten und Institutionen, um das Böse in kollektiver Mitwirkung, in der Exklusion und Marginalisierung, exzessiven Strafen und in der Despotie. Es gibt böse Gegenden und Anziehungspunkte und böse Zeiten wie Kriege. Administrative Massentötung richtet sich gegen Menschen und Tiere, das Böse wuchert auch im „Krieg gegen das Böse“. Im dritten Teil werden Gegenkräfte des Bösen untersucht: Neben den präventiven Mitteln gibt es auch ein weites Spektrum der Nachverarbeitung des vergangenen Bösen durch angemessene Erinnerung, Schuldgefühle und Reue. Tadel und Strafe sind zweischneidige Antworten auf das Böse. Problematisch ist auch das Programm einer Umerziehung der menschlichen Natur. Anstelle von „Lösungen“ zur Elimination des Bösen werden Korrektive wie z. B. ein moderater und konstruktiver Egoismus erwogen.
Tierethik
- 188 stránek
- 7 hodin čtení
Jean-Claude Wolfs Tierethik gehört zu den Standardwerken der deutschsprachigen tierethischen Diskussion.Erstmals 1992 erschienen, ist das Werk nach wie vor eine der besten Einführungen in die Grundlagen und zentralen Argumentationslinien der Tierethik. Für die Neuausgabe wurde der Text durch ein Nachwort und eine Bibliographie zu Neuerscheinungen seit 1992 ergänzt.
Tierrechte - Menschenpflichten: Tierethik
Neue Perspektiven für Menschen und Tiere
- 149 stránek
- 6 hodin čtení
Jean-Claude Wolfs Tierethik gehört zu den Standardwerken der deutschsprachigen tierethischen Diskussion. Erstmals 1992 erschienen, ist das Werk nach wie vor eine der besten Einführungen in die Grundlagen und zentralen Argumentationslinien der Tierethik. Für die Neuausgabe wurde der Text durch ein Nachwort und eine Bibliographie zu Neuerscheinungen seit 1992 ergänzt.