Ursula Rabe-Kleberg Knihy
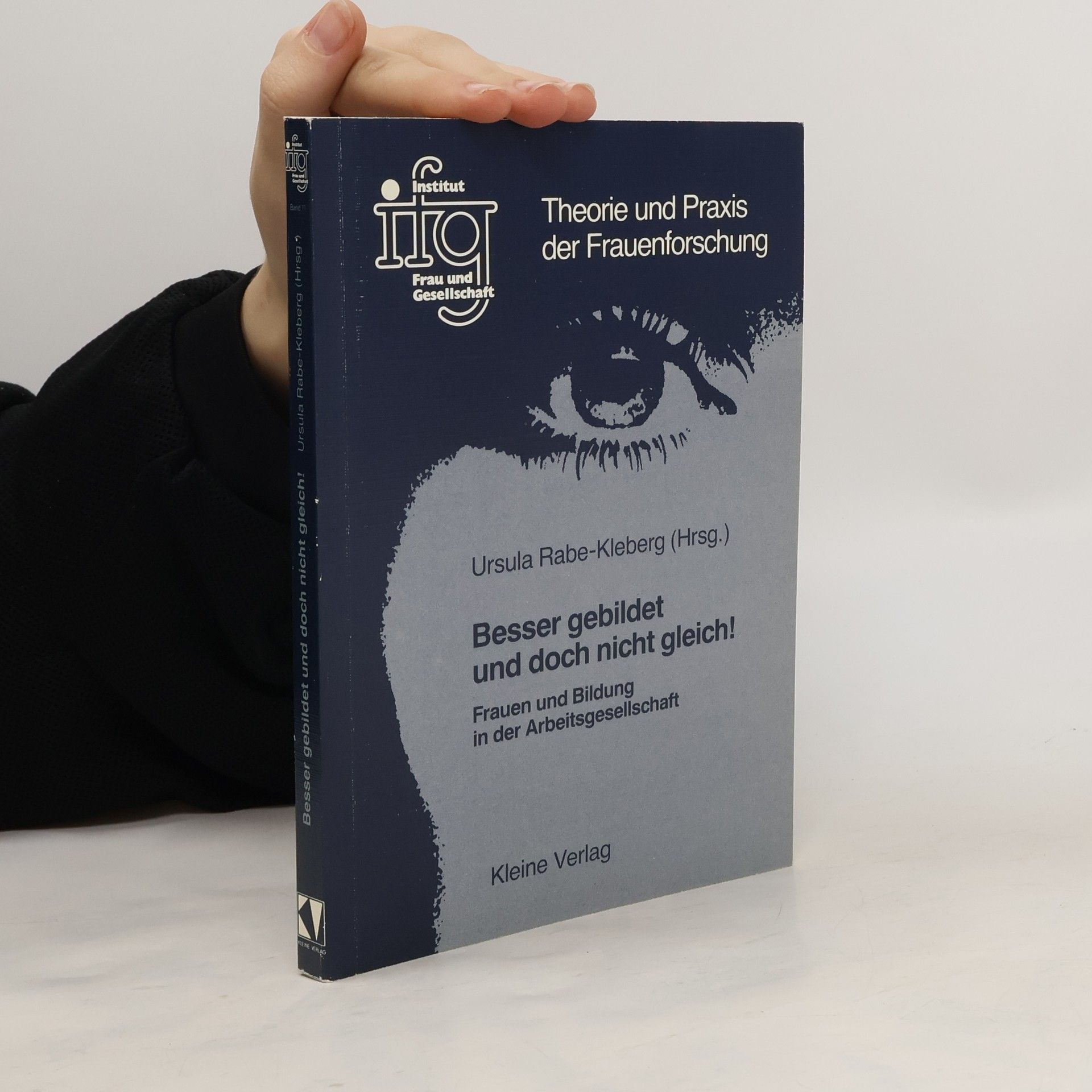
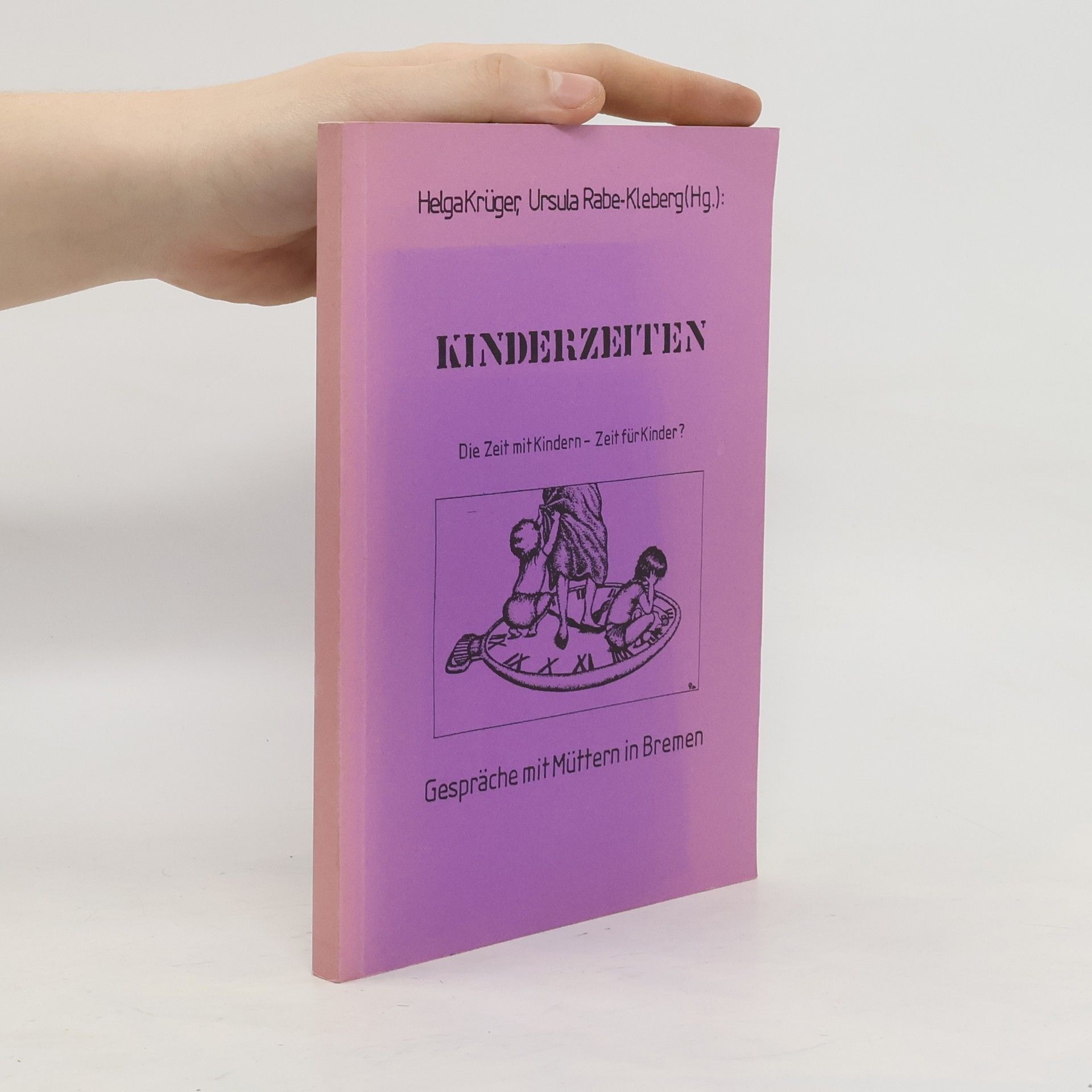
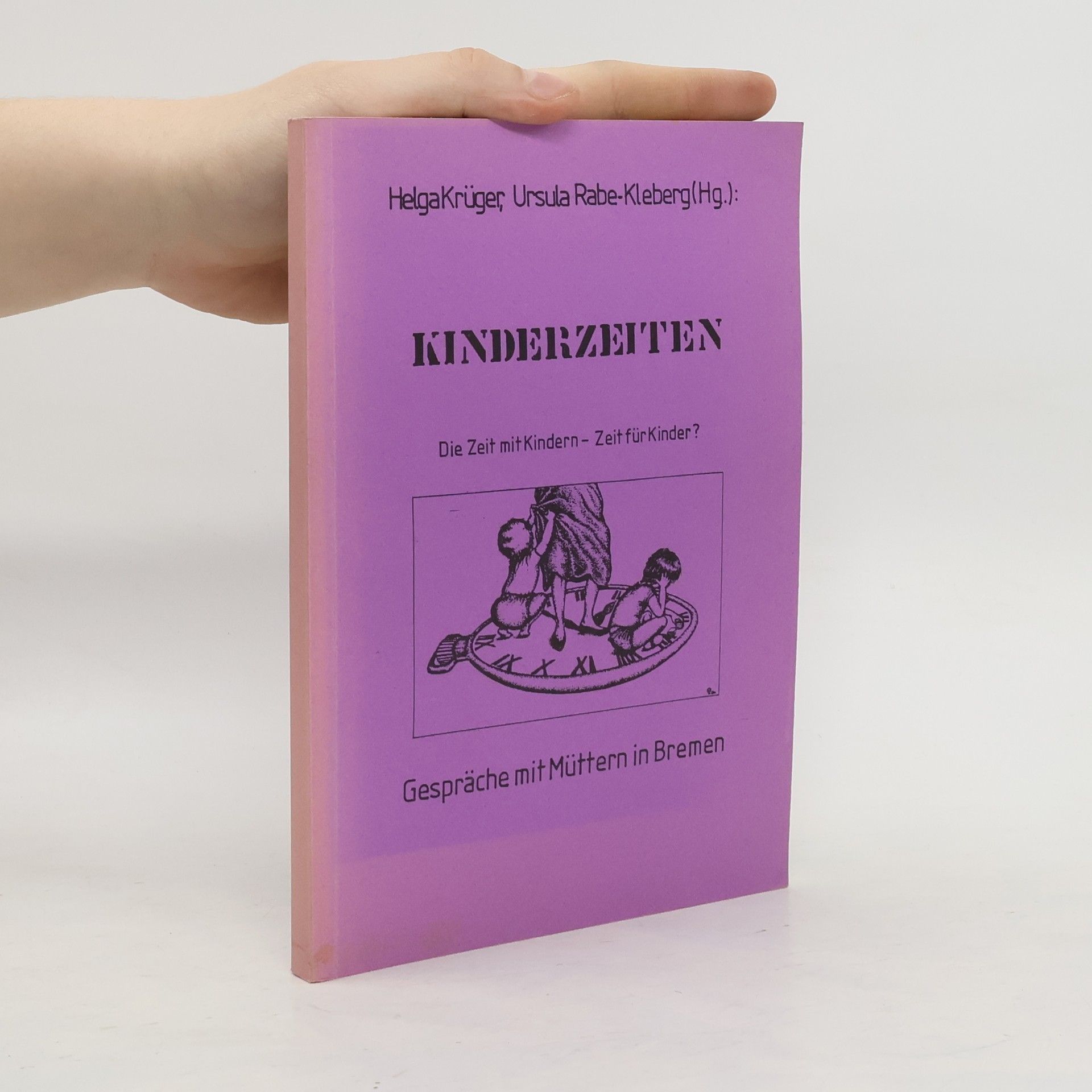
Noch nie gab es so viele gut ausgebildete Frauen, doch ihre beruflichen Chancen sind im Verhältnis dazu schlecht. Das gesellschaftliche Verhältnis von Bildung und Arbeit, in dem Bildung als Voraussetzung und Legitimation für berufliche Positionen gilt, scheint für Frauen gestört. Trotz ihrer Bildungsanstrengungen unterliegen Frauen weiterhin traditionellen Diskriminierungsprozessen. Oft werden die eingeschränkten Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt mit fehlenden Qualifikationen und unzureichender Ausbildung erklärt. Es wird erwartet, dass bessere Bildung für Mädchen und Frauen entscheidend zur Aufhebung der Geschlechterungleichheit beiträgt. Obwohl das Ziel, gleiche Bildungschancen zu schaffen, nach der Einführung von Koedukation und dem Anstieg qualifizierter Bildungsabschlüsse erreicht zu sein scheint, bleibt die Gleichung „gleiche Bildung = gleiche Chancen“ für Frauen unerfüllt. Ihre Erfolge werden nicht entsprechend gewürdigt. Der Reader untersucht das Missverhältnis von Bildung und Arbeit bei Frauen, analysiert Ausgrenzungstendenzen und zeigt, dass das historische Bildungsprojekt der Frauenbewegung nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann. Die aktuellen Herausforderungen finden vor allem an der Schnittstelle zwischen Arbeit und Bildung statt.