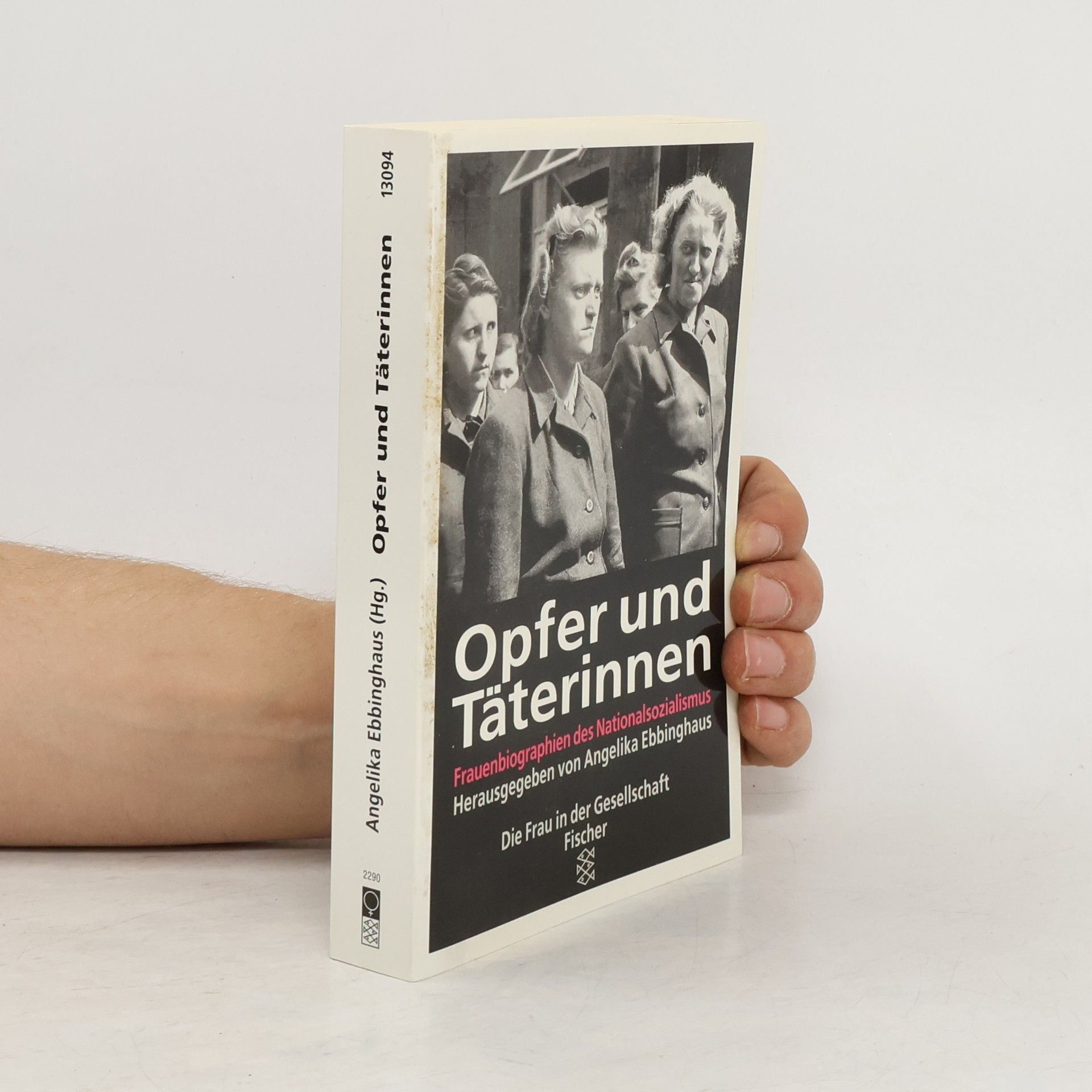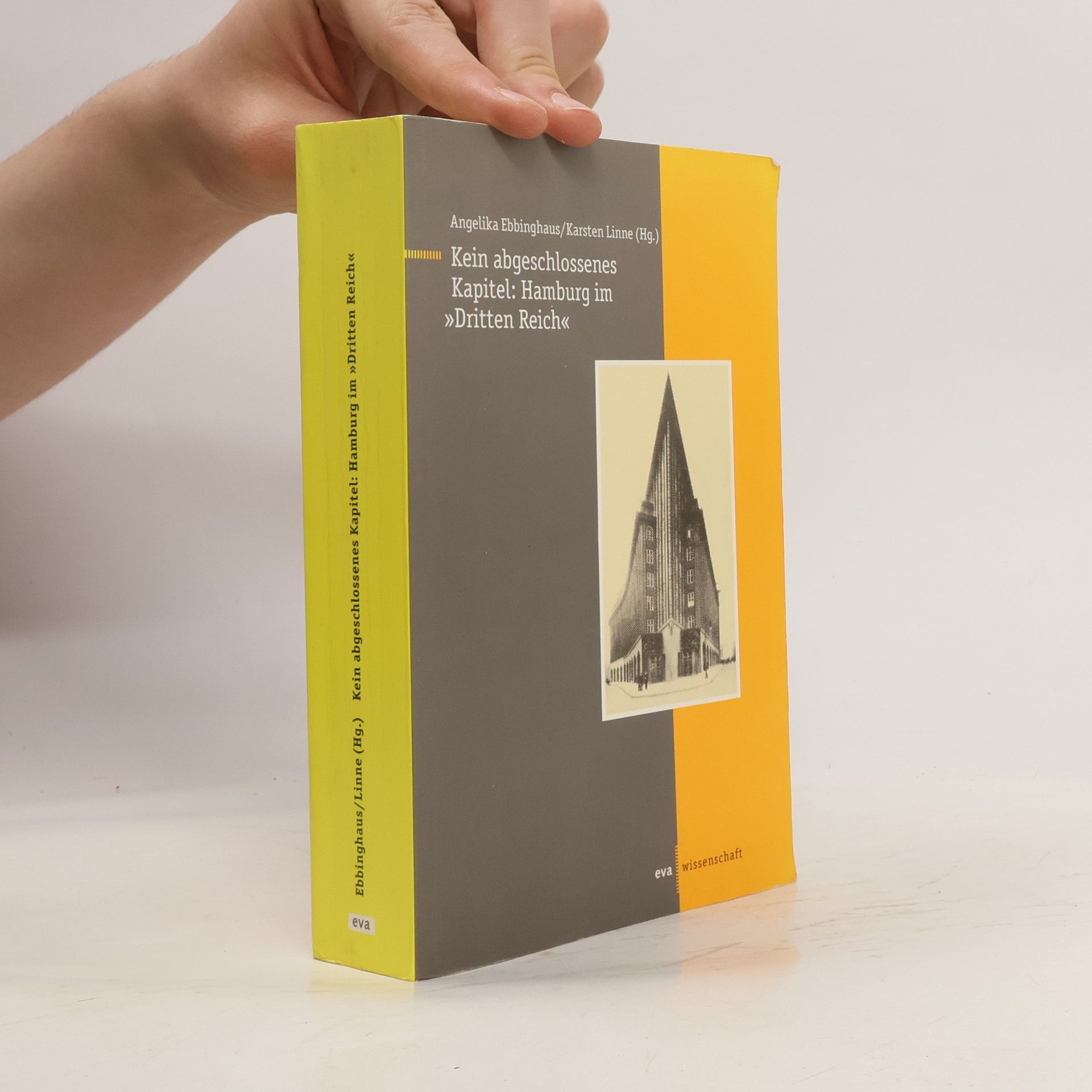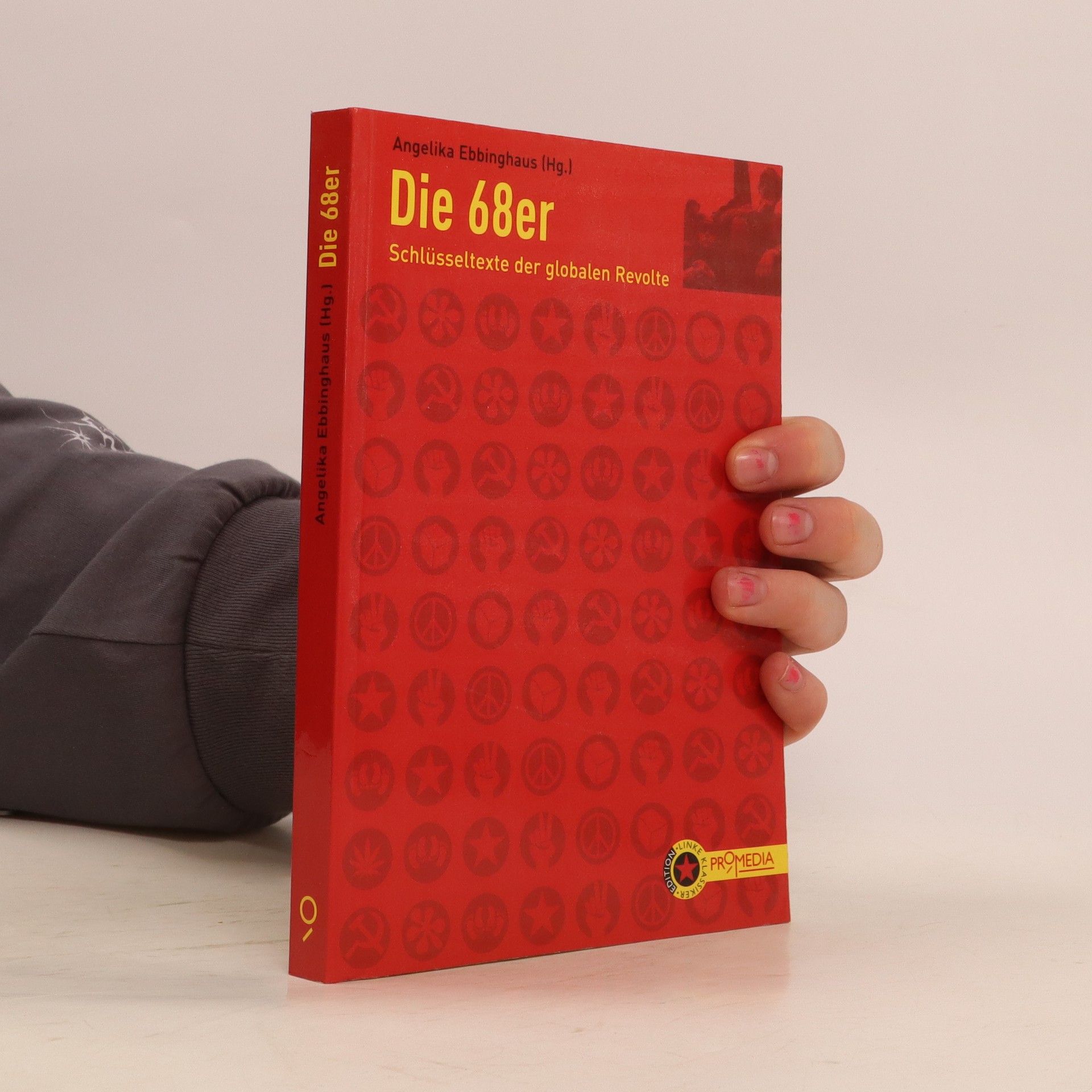Vernichten und Heilen
- 675 stránek
- 24 hodin čtení
Von 1946 bis 1949 verhandelte das amerikanische Militärgericht die Verbrechen hochrangiger NS-Ärzte: unzählige Menschenversuche an KZ-Häftlingen mit Fleckfieber, Malaria, Kälte, Höhendruck und Sterilisation, aber auch die Tötung psychisch Kranker und geistig Behinderter ("Euthanasie"). Angeklagt im Nürnberger Ärzteprozess waren 23 NS-Mediziner aus Administration, Militär und SS. Sie waren keine "Monster", sondern töteten vorgeblich, um zu heilen und "drängende Probleme" in Kriegschirurgie, Seuchen- und Luftfahrtmedizin zu lösen. Alle Angeklagten erklärten sich "nicht schuldig". "Vernichten und Heilen" hinterfragt diese fatale Ethik, die "den Fortschritt" und das Wohl der Gesellschaft über das Wohl des einzelnen stellt. Den Prozess, seine Vorgeschichte und Hintergründe rekonstruieren namhafte MedizinhistorikerInnen in diesem Band.