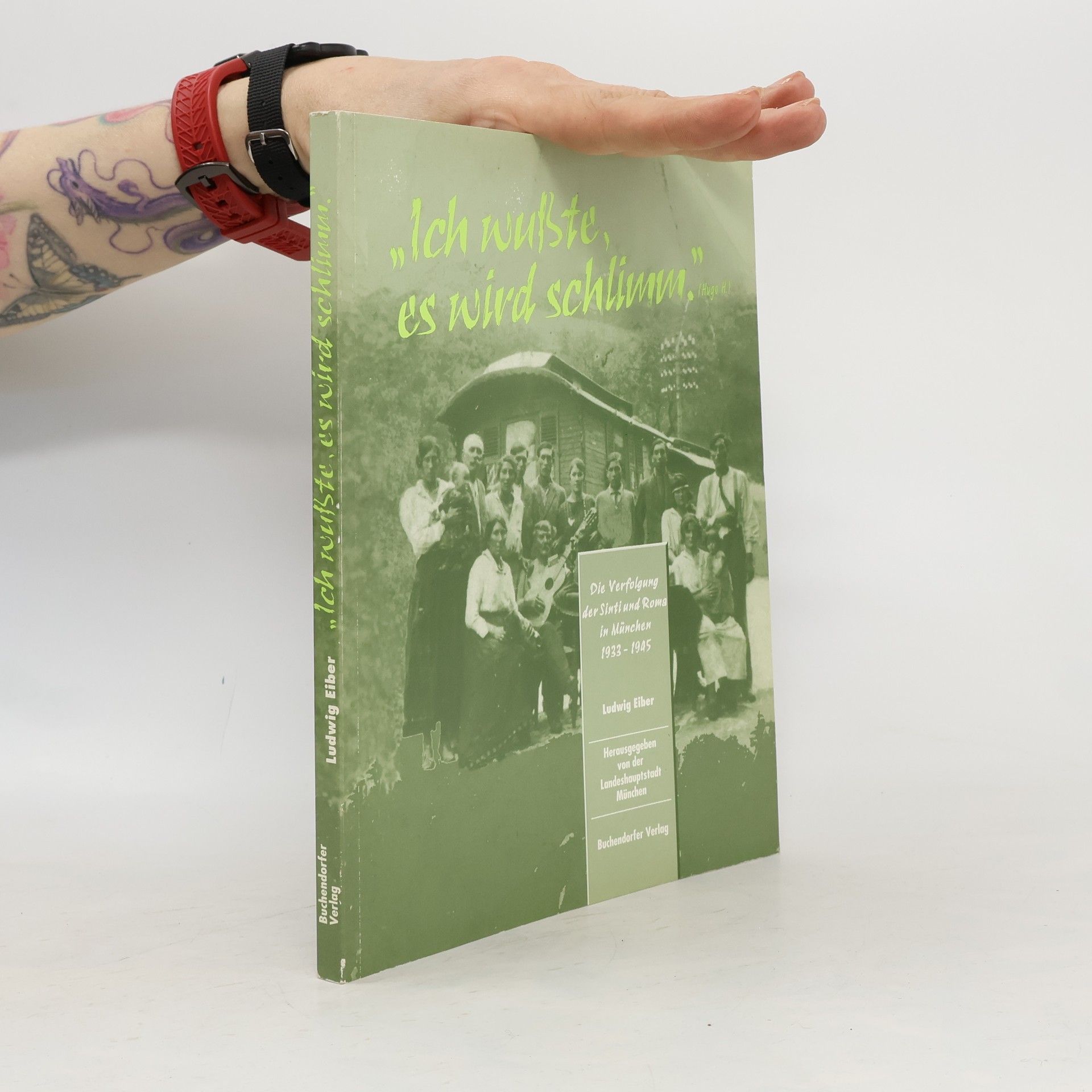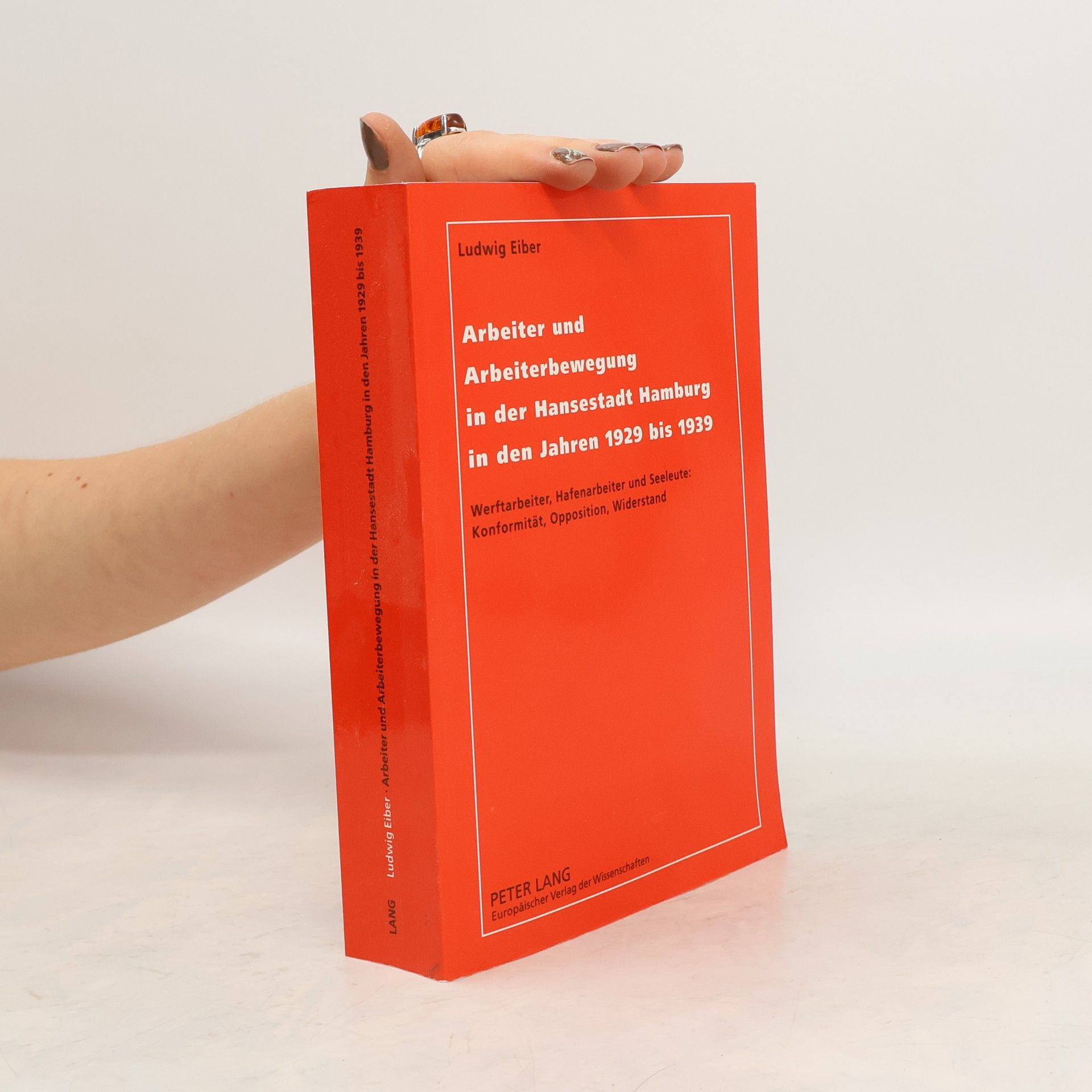Bayern und Böhmen
Kontakt, Konflikt, Kultur; Vorträge der Tagung des Hauses der Bayerischen Geschichte und des Collegium Carolinum in Zwiesel vom 2. bis 4. Mai 2005
- 399 stránek
- 14 hodin čtení
Der Titel kann ab Januar 2013 über die Südost Verlags Service GmbH, Waldkirchen, bezogen werden. Wie beschreibt man am besten „1500 Jahre Nachbarschaft“ - so der Untertitel der Bayerischen Landesausstellung „Bayern-Böhmen“? Natürlich indem man Themen näher beleuchtet, die von den frühen kirchlichen Beziehungen bis zur heutigen Wahrnehmung der Grenze reichen, also indem man versucht, die gesamte Zeitspanne zu umfassen. Aber auch, indem man Fragen nachgeht, die die große Vielfalt der Beziehungen verdeutlichen: politische Verbindungen, Wirtschaftskontakte, Pilgerwesen, Arbeitsmigrationen, tschechische Exilanten nach 1968, bayerische Architekten in Prag und böhmische Kunststudenten in München. Und indem man konfliktreiche Themen nicht ausspart, wie das nationalsozialistische „Sudetenbayern“ oder Flucht, Vertreibung und die Sudetendeutschen in Bayern nach 1945. All dies prägte jahrhundertelang das Verhältnis von Bayern und Böhmen und findet sich in dem reich bebilderten Aufsatzband wieder.